Erlebnisse auf dieser Seite
Halbgötter in Nadelstreifen von Jürgen Hühnke
Heimattümelei? von Jürgen Hühnke
Es geht alles vorüber... von Fritz Schukat
Die gute, alte Volksschule von Jürgen Hühnke
Der Treueid von Jürgen Hühnke
Meine Schulzeit von Walter Bosniakowski
Die Mauer von Uwe Neveling
Lehrer Lehrer! von Fritz Schukat
Meine ersten Schuljahre von Fritz Schukat
Einschulung 1964 von Hans Meier
Schule damals von Rolf Rehder
Schulzeit von Edith Kollecker
Lehrers Geburtstag von Edith Kollecker
Hausaufgaben – Kartoffelkäfer von Annemarie Lemster
Lernen, was ist das? von Annemarie Lemster
Mit Gebrüll ins Schulleben von Annemarie Lemster
Schulspeisung 1947 von José O. Probst
Die Dorfschule von Ellen Probst
Schule im Krieg von Ellen Probst
Abiturientenprüfung 1939 von Ingeborg Nygaard
Die Schultüte von Ingeborg Nygaard
Schulzucht vor fünfzig Jahren von Jürgen Hühnke
Ein Fall von Schulversagen von Jürgen Hühnke
Lob der Volksschule von Jürgen Hühnke
Macho-Probleme von Jürgen Hühnke
Aufklärung von Jürgen Hühnke
Schulspeisung von Fritz Schukat
Talentiert von Uwe Neveling
Erinnerung an die Schulzeit von Uwe Neveling
Kopfrechnen von Uwe Neveling
Wie Steine in den Rucksack kamen von Uwe Neveling
Warum waren sie anders ? von Annemarie Lemster
Konkav und nicht konvex von Jürgen Hühnke
Kampagne im Desinteresse der Bevölkerung von Jürgen Hühnke
Halbgötter in Nadelstreifen
von Jürgen Hühnke erstellt 01.08.2013
In Preußen, im Königreich und Bundesland des Deutschen Reiches, trugen die obersten Bildungsgewaltigen den Titel „Minister für Unterricht und Kultus". Die Bundesrepublik hat daraus „Kultusminister" gemacht, obwohl deren Aufgabe mit der Religionspflege absolut nichts mehr zu tun hat. Umso mehr halten sich diese Politiker - wie die meisten dieser Kaste sonst - mindestens für Halbgötter in Nadelstreifen, wie denn die KMK, die Kultusministerkonferenz, Gesetze par ordre du mufti erlässt, so im August 1995 die Regelung der sog. „Neuen Rechtschreibung".
Was uns da aufgedrückt wurde, war erdacht worden mit dem Bestreben, dem Deutschen den Ruch der „schweren Sprache" zu nehmen und allen echten und unechten Legasthenikern deren Erlernen puppenleicht zu machen. Das Ergebnis fiel in seiner Verdummung derart miserabel aus, dass schon 2006 erste Reformen der Reform erforderlich wurden.
Ich kann die Sprachverhunzer nur Gramm- und Linguastheniker nennen, d.h. Leute, die von Grammatik und Sprache nichts verstehen. Zum Beispiel schreiben sie alles, was auf „das" oder „im" und „am" folgt, unterschiedslos groß, als wären es wirkliche Hauptwörter, während die alte Duden-Schreibung nur „wirkliche" Nomina versal beginnen ließ, nicht aber adverbiale Wendungen, die wie Adverbien klein zu schreiben waren, so „in bezug" = bezüglich, „aufs vortrefflichste" = besonders vortrefflich, „im besonderen" besonders usw.
Was macht ein armer Schüler von heute, wenn ihm „Dass das das darf" diktiert wird - viermal groß schreiben (Satzanfang + dreimal nach „das") ???
Viele, viele Wörter, die man seit Jahrhunderten mit einem „e" schrieb, werden auf „ä" geändert: Gämse (weil Gamsbock), Stängel (weil Stange). Na, gut und schön, aber was ist mit den Alten oder Eltern? Warum nicht auch Ängel (zu: angelus) oder Ängländer (zu: Angelsachsen) oder auch, dem Stadtwappen angepasst, Bärlin und „fährtig“ = fahrbereit?
Das grammatische, syntaktische und etymologische Denken wird gänzlich untergebuttert, so auch beim „Quäntchen", das mit „Quantum" nun null zu tun hat und vielmehr auf „Quint" zurückzuführen ist, wie denn ein kleiner Geldbetrag um 1900 noch „Fünfer" hieß oder, duodezimal, „Sechser" für den halben Groschen. Also liegt kein e:ä-‚ sondern ein e:i-Wechsel (wie helfen - hilf) vor.
Den Buchstaben „eu" traf es ebenfalls. Wörter damit haben in älterer Sprach oft „ie" - Teufel heißt der böse Kerl in der Tiefe, kreucht und fleucht ist älteres kriecht und fliegt.
Das Schneuzen ist älteres Schniezen" also nahe beim Schniefen liegend, der Schneuzer
ist gewissermaßen der Tropfenfänger dazu. Nach fälschlicher Ableitung von „Schnauze" soll man jetzt „Schnäuzer" schreiben, womit der Mensch auf den Hund kommt, der angeblich auch nicht autonom denken kann.
Nicht zuletzt die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtags erwiesen sich als nadelgestreifte Halbgötter, als sie das Ergebnis eines Referendums vom September 1998 (56,32% gegen die Neue Rechtschreibung!) mir nichts, dir nichts abbügelten.
Das ist ein wahrhaft göttlicher Umgang mit der Demokratie!
Heimattümelei?
von Jürgen Hühnke erstellt im Juli 2013
Die Kultusminister können es einfach nicht lassen, immerfort etwas am
Schulwesen herumzuwerkeln und damit ideologische Gräben zu vertiefen. In Schleswig-Holstein wurde kürzlich ein neuer Graben ausgeworfen, indem das Grundschulfach „Heimat- und Sachkunde" um den Bestandteil „Heimat" gebracht werden sollte - wegen starker Vorbehalte gegen die Heimattümelei.
Andere Bundesländer waren in der Nomenklatur-Reform vorangegangen. In diesem Zusammenhang ist eigentlich erstaunlich, dass die weiland DDR ebenfalls ein Fach „Heimatkunde" führte. Gern sprachen die Margot-Honecker-Getreuen von der „sozialistischen Heimat", die auch als „sozialistisches Vaterland" tituliert wurde, so dass man jenes Fach als verkappte Staatsbürgerkunde ausmachen kann, was aber für den Westen ebenfalls gilt, da die Heimat- und Sachkunde unter anderem darin bestand, die örtliche Feuerwehr zum Thema zu machen.
Das Negativ-Argument von einer „Gefühlsduselei" geht im Grunde, wenn auch eben die Heimat nicht betreffend, auf das Großmaul Adolf Hitler zurück, der - aus gutem Grund - empathische und humane Gefühlsregungen damit prophylaktisch verächtlich machte. Er geiferte auch gegen „Humanitätsduselei“.
Der neue Schwenk im Kultusministerium ist so erstaunlich nicht, haben wir doch noch die Vorwürfe im Ohr, die Heimatvertriebenen kaschierten hinter der Heimat-Nostalgie nur ihren Revanchismus.
Aber mal ehrlich: Hat nicht jeder, der die Stätten seiner Jugend besucht oder sich ihnen nähert, gewisse nostalgische Anflüge? Ähnlich ergeht es Zeitzeugen, wenn sie von Erlebnissen in Kindheit und Jugend erzählen oder ganz einfach sich an frühere Zeiten erinnern.
Eines aber hat sich mit dem Industriezeitalter grundlegend gewandelt: Seit er über ein erhebliches Maß an Mobilität verfügt, geht dem Menschen der Mikro- und Makrokosmos der Jugend verloren. Mit Studium und Ausbildung verlässt er die Geburtsheimat und siedelt spätestens bei Berufsanfang in die zweite, die Wahlheimat, um. Hier tritt er nicht selten Vereinigungen verschiedenster Art bei, wodurch er sich in die neuen Kreise integriert und durch aktives Engagement sich nicht nur quasi das Bürgerrecht erobert, sondern diese neue Heimat „aneignet", ohne dass das alte Milieu vergessen wird. Übrigens ist die Ministerin, die den treffenden Familiennamen „Wende" trägt, nach erster Kritik rasch zurückgerudert und lässt das Fach jetzt „Heimat-, Sach- und Weltkunde" heißen.
Es geht alles vorüber...
von Fritz Schukat aufgeschrieben am 25.07.2014
Sitzen geblieben! Im Zeugnis hieß das lakonisch: Nicht versetzt. Und das kurz vor dem Ziel, von der 12. Klasse in die 13., also die letzte Klasse, in der man die Schule mit der Reifeprüfung, dem Abitur abschließt - oder eben nicht.
Gut, ich war nicht der einzige. Mit mir blieben zwei weitere Schüler kleben, aber warum ich? Der Glaube an die „Gutheit“ der Menschen war dahin. In drei Fächern hatte ich konstant seit Jahren immer eine zwei, also ein „gut“, habe mich mit meinem Englischlehrer grundsätzlich in Englisch unterhalten und konstant ein „gut“ bekommen, aber drei Zensuren wurden schlimm-verbessert. Ich hatte mich mit meinem Mathelehrer angelegt, der auch Chemie und Physik unterrichtete. In diesen drei Fächern bekam ich „Fünfer“, die mir das Genick brachen. So etwas kann heute nicht mehr passieren, der Lehrer hätte sofort einen Prozess am Hals. In drei Hauptfächern unterrichtet heute auch kein Gymnasiallehrer mehr, das würde ihn stark überfordern, aber damals, in den frühen 1950er Jahren gab es keine Wahl und ein Lehrer vom Kaliber unseres Mathe-Lehrers konnte schon Schicksal spielen!
Unser Ordinarius versammelte seine schwarzen Schäfchen um sich und versuchte, Trost zu spenden. Er erzählte etwas über seine vergeblichen Versuche, während der Lehrerkonferenz wenigstens den einen oder anderen zu retten, auch mir erzählte er dies im beschwichtigenden Tonfall, doch am Ende nutzte das nichts, wir waren verdammt dazu, eine Ehrenrunde zu drehen.
Natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass mir das passieren würde und schluckte es runter. Bis jetzt hatte ich aber erst die eine Hälfte meines Leidensweges absolviert. Ich musste mir auch noch zu Hause mit fast 19 Jahren wie der kleine Franz meine „Schläge“ abholen. Was geht einem in solcher Situation alles durch den Kopf? Am Ende blieb übrig, dass ich mir versprach, an dieser Schule mein Abi nicht zu machen. Ich werde mir eine andere Schule suchen. Meine Cousine, ein Jahr jünger als ich, kannte alle Oberschulen in Schöneberg. Eine davon würde sie mir sicher empfehlen können. Allein dieser Gedanke tröstete mich schon ein wenig und auf der Heimfahrt mit meinem Fahrrad fiel mir dann der alte Schlager ein: „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei...“, der in den Kriegsjahren entstanden, zu einer Art Durchhalteparole geworden war.
In den Tagen danach traf ich mich mit meinen beiden Schicksalsgenossen und wir beratschlagten, was wir machen könnten. Beide teilten meinen Plan und ich traf meine Cousine, um mir einige Informationen geben zu lassen, welchen Level sie schon erreicht hätten, um abzuwägen, ob wir uns dort anmelden sollten. Nachdem wir aber im Sekretariat dieser Schule hörten, dass wir in eine reine Mädchenklassen kommen würden, gab es schon die erste Beerdigung. In der zweiten Schule passten die Voraussetzungen besser, also meldeten wir uns dort an. Meine beiden Kumpanen standen das aber nicht durch, sie verließen die Schule bereits im Laufe des Schuljahres. Ich war standhaft, denn ich merkte, dass ich dort das Pensum, das in fast allen Fächern durchgenommen wurde, bereits in der alten Schule gepaukt hatte. Es war also reine Wiederholung.
Zwei Jahre nach dem Debakel machte ich 1956 mit 11 Mitschülern in einer der kleinsten Klassen, die ich je frequentierte, mein Abi.
Im Laufe meines Lebens habe ich öfter einige Sachen noch einmal beginnen müssen. Immer fiel mir dann dieses Durchhaltelied von Fred Raymond ein, das später auch Lale Andersen sang: „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei...!“
Die gute, alte Volksschule
von Jürgen Hühnke erstellt Juli 2013
Viele Menschen hegen eine große Aversion gegen die Schule, eine Phobie, der oft ein persönliches Versagen zugrunde liegt, ebenso oft aber die leidige Erfahrung. Im Unterschied und Gegensatz dazu habe ich die Schule als sehr angenehmen Ort in der Erinnerung. Mein Langzeitgedächtnis produziert allerdings Bilder aus dieser Zeit nur sehr bruchstückweise. Eigentlich erinnere ich mich kaum an Schulangelegenheiten, während der Schulweg - drei Kilometer vorwiegend an einem Bahndamm entlang mit im Winter tief verschneiten Gräben, in denen ich versackte - viel lebhaftere Eindrücke hinterlassen hat.
Das Gebäude meiner Grund- bzw. Volksschule war ein typischer, preußischer, gründerzeitlicher Zweckbau der 1880er Jahre mit hohen Fenstern und Klassensälen. Das Mauerwerk bestand aus einfachen Ziegeln, doch waren in die Risalite und zudem als Friese glasierte Klinker eingefügt.
Von der Innenarchitektur hat sich mir nur das Treppenhaus eingeprägt und das deshalb, weil Anfang 1945 auf dem Dachboden untergebrachte Flüchtlinge die ausgetretenen Stufen mit ihrem Auswurf wie mit Kutscherrotz glitschig machten, was einen widerlichen Anblick bot.
Der alte Herr Voss, unser ziegenbärtiger Lehrer, verfügte durchaus über einen Rohrstock, doch ist mir dessen Einsatz im Langzeitgedächtnis nicht gegenwärtig, was aber daran liegen mag, dass ich als (zumeist) braver Schüler nicht in den Genuss dieses Instruments kam.
Aus der Zeit des Kriegsendes ist eine Episode bei mir hängen geblieben, die Erinnerung an eine Aufgabenstellung. Aufgaben muss ich ohnehin recht gern erfüllt haben, da ich schon am ersten Schultag statt zweier Reihen von Sütterlin-"i" - bei meiner Einschulung 1941 war diese Normschrift noch üblich, bevor Hitler eingeflüstert wurde, die Fraktur sei eine Erfindung jüdischer Buchdrucker - gleich die ganze Schiefertafel vorn und hinten damit füllte.
Besagte Aufgabe 1945 bestand darin, das Schulhaus zu vermessen und den Grundriss maßstabsgerecht aufzuzeichnen. Bei Viertklässlern würde man das heute für eine totale Überforderung halten. Aber das war wohl das Geheimnis der damaligen Volksschule, die auch sonst eine reine Paukanstalt mit starkem Gedächtnisdrill war, dass aus ihr viele erfolgreiche Handwerker usw. hervorgingen. Jedenfalls hat sie mir nicht geschadet. Meine mathematische und besonders geometrische „Kompetenz", wie man heute sagt, war vielmehr in hohem Maße angesprochen. In meinem Grundriss fehlten auch die Pfeiler und Risalite nicht.
Im Frühjahr 1945 wechselte ich auf die Nachbarschule völlig gleichen Typs über, eine Mittelschule, deren Lehrer mir am Schuljahrsende empfahlen, die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium zu machen. Trotz vieler gegenteiliger Behauptungen von heute bestand, einmal von jener Aufnahmeprüfung abgesehen, doch so etwas wie eine Durchlässigkeit im Bildungssystem.
Wenn meine Erinnerungen an die Schulzeit auch sehr spärlich ausfallen, wage ich zu behaupten, die alte und verrufene preußische Volksschule sei ein Erfolgsmodell gewesen. Ich sehe bei diesem Urteil einfach auf meinen Vater, der Absolvent einer solchen Schule und gelernter Schriftsetzer war, der perfekter in Wortschatz, Grammatik, Orthografie und Interpunktion war, als ich es je bei meinen späteren Deutsch-Leistungskurs-Schülern erleben durfte.
Der Treueid
oder: Aufmüpfige Eidgenossen
von Jürgen Hühnke
Mitte September des Jahres 1968 trat ich mit einer Gruppe Studienreferendare, die fast in Bataillonsstärke angetreten war, durch jenes Portal, über dem man in edlem Latein einen Spruch geschrieben fand, die Nachwelt möge würdig die Freiheit zu bewahren sich bemühen, welche die Alten errungen hätten. Eben dieser hehre, ehrwürdige Vers am Hamburger Rathaus passte trefflich zum Anlass der Zusammenkunft; denn es ging an diesem Tage um die Ablegung des Treueids zwecks dauerhafter Übernahme in die Reihen der hansestädtischen Beamtenschaft.
Für den feierlichen Akt betrat die Anwärterversammlung einen piekfein getäfelten und mit handgemalten Senatorenporträts ausgestatteten Saal im Obergeschoss, dessen Gepräge die Pathetik des Eingangsspruches bei weitem übertraf. Da war es fast schon enttäuschend, dass der Herr Schulsenator ohne güldene Amtskette erschien. Er kehrte allerdings auch gleich auf dem Absatz um mit der empörten Bemerkung, er werde einen solchen Haufen nicht in den Staatsdienst übernehmen. Da waren nämlich einige Aktivisten aus der Gruppe zu ihm getreten und hatten verkündet, sie würden sich - oder wir uns - dem Treueid als autoritärem Zopf verweigern.
Das war mir völlig neu. Jedenfalls hatte ich an einer Abstimmung über diese Verweigerung nicht teilgenommen. Es musste daran liegen, dass ich mit einigen Referendarskollegen im Studienseminar überkreuz geraten war, indem ich in der Diskussion um eine moderne Sexualerziehung dummen linkssoziologischen Thesen und Theorien widersprochen hatte. Da war es um so alberne Ansichten gegangen wie die, man solle von der Theorie in die Praxis übergehen und die Schüler in der Sporthalle auf den Matten üben lassen. Solche kumpelhafte Anbiederung von Erziehern an die Pubertanden sei aus entwicklungs-psychologischen Gründen unpädagogisch und ganz und gar kontraproduktiv, hatte ich dagegengehalten. Also deshalb hatte man mich zur Vergeltung nicht in die Streikabsicht eingeweiht.
Des Senators Umkehr und seine Drohung mit der Nicht-Verbeamtung brachte die paar übereifrigen Aktivisten ihrerseits zu einer Kehrtwende. Brav ließen sie die Zeremonie über sich ergehen. Der ganze Akt hatte auch nichts Unpersönliches an sich. Im Unterschied zu Gelöbnissen der Bundeswehr kam es hier nicht zu einem kollektiven Eidesgemurmel, vielmehr sprach jeder einzeln die Bekräftigungsformel „Ich gelobe es!" Dem hängten außer mir - ich habe mitgezählt - freilich nur zehn Leutchen ,,...so wahr mir Gott helfe!" an. Denn Gott war eine Autorität und jenseits der kritischen Altersgrenze. Ich erwähnte ja, dass sich die Begebenheit im Jahr 1968 zutrug, als die akademische Jugend gegen jede Art von Establishment und Autorität revoltierte: „Trau keinem über dreißig!"Die innenpolitischen Probleme des sogenannten „Berufsverbots" folgten erst einige Zeit später, als sich die von der Eidesleistung Betroffenen so sehr erholt hatten, dass sie neue Autoritäten anbeteten, Ernesto Che Guevara oder Ho Tschi Minh. Dem Establishment erwiesen sie ihre Reverenz, indem sie sich bemüßigten, den „Marsch durch die Institutionen" anzutreten, und zum Beispiel ... Lehrer wurden.
Meine Schulzeit
von Walter Bosniakowski
Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Bauerndorf in Masuren, dicht an der polnischen Grenze (nach dem Polenfeldzug war es die russische Grenze).
In unserem Dorf war auch ein Schulgebäude mit einer Wohnung für einen Lehrer und zwei Räumen für den Unterricht in 4 Klassen. Eine Bankreihe gleich eine Klasse. Bis Kriegsbeginn hatten wir zwei Lehrer, dann wurde der Junglehrer zur Wehrmacht eingezogen. So blieb uns nur noch ein gut beleibter Lehrer, der auch gleichzeitig Ortsgruppenleiter und SA-Mann war. Dieser Lehrer unterrichtete dann 8 Klassen in 2 Räumen. Ab und an waren Parteiveranstaltungen während der Schulstunden, so dass der Unterricht ausfiel und wir mit Freunden nach Hause gingen. Zur Schule ging ich und wohl die meisten Kinder immer mit Unbehagen und Angst, denn geschlagen wurde oft. Mit der Handfläche ins Gesicht, meistens mit der Rute auf die Handflächen. Am schlimmsten war es mit dem Stock auf den Hintern.
Dass ich mit meinen Eltern am Sonntag zum Gottesdienst ging, war dem Lehrer ein Dorn im Auge. So schickte er mich für eine Woche in die Stadt zur HJ-Schule. Das Gute in dieser Woche waren die Geländespiele. Alles andere war für mich teils grausam, so z.B. die Schikane abends, wenn wir Jungen schon eine Stunde im Bett waren. Das Bett war eine Matratze auf dem Fußboden, dazu eine Decke. Es kam die „Nachtvisite", das war ein HJ-Mann. Beanstandete er etwas im Raum, mussten wir nackt im Waschraum antreten und die bekannten Sprüche aufsagen, wie z.B."Hitlerjungen sind flink wie die Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl“. Währenddessen wurden wir mit einem Schlauch kaltem Wasser ''begossen“ , dabei musste man stramm stehen und durfte sich nicht bewegen. Ich war froh, als die Woche zu Ende war. Mein Lehrer war ein fanatischer Hitlergefolgsmann und versuchte dahingehend auch uns Kinder zu erziehen.
Dazu ein Beispiel: Wenn ich das Braunhemd anziehe und meine Eltern mich hinderten, zum Jungvolkdienst zu gehen, und mich dabei auch noch anfassen, dann haben sie sich am Führer vergriffen und dann sollte ich dies melden. Als ich das mal meinem Vater sagte, da hat er mir eine gelangt.
Im Sommer 1944 war es mit der Schulzeit zu Ende. Die Front war schon nahe der Grenze und wir mussten das Dorf verlassen. Im Herbst 1944 begann dann die große Flucht.
Die Schulzeit habe ich nicht beendet und lebe bis heute ohne Schulabschluss.
Die Mauer
von Uwe Neveling
Mauern sind in der Regel Begrenzungen. Mauern haben eine Innen- und eine Außenseite. Ist die Mauer hoch, so weiß man oftmals nicht, was sich auf der anderen Seite befindet. Eine Mauer muss nicht immer aus Stein sein. Sichtblenden und Bretterzäune haben die gleiche Wirkung, nur ist eine Steinmauer stabiler.
Ich erinnere mich an eine Stunde im Religionsunterricht. Unser Religionslehrer war ein junger Vikar. Er kam aus dem nördlichen Sauerland. Wir mochten ihn, weil er auf unsere Probleme einging. Er scheute kein Thema und besprach es mit uns aus religiöser Sicht. Dazu gehörten auch Sexualität und Jazz, um nur einmal die extremen Eckpunkte zu nennen. In den fünfziger Jahren waren das bei den älteren Lehrkräften Tabuthemen. Er war für uns eine Vertrauensperson. Wir freuten uns jedes Mal auf das gemeinsame Zeltlager mit ihm. Bei den Ausflügen wusste er immer Wissenswertes über Land und Leute zu berichten. Mit seinem sauerländischen Humor gab er seinen Erzählungen sehr oft eine überraschende Wendung. Eines Tages berichtete er von einem Kinobesuch.
Er hatte den Film „Lohn der Angst“ gesehen. Es ging dabei um eine brennende Ölquelle, die mit Nitroglycerin gelöscht werden sollte. Das hochexplosive Glycerin musste von weit her zum Bohrloch transportiert werden. Es wurde auf zwei Lastwagen verladen. Die Fahrzeuge fuhren in gehörigen Abständen durch unwegsames Gelände. Ein Wagen explodierte. Die Explosion zerriss eine Ölleitung, und das Öl bildete einen pechschwarzen Ölsee. Der zweite Wagen müsste da durch. Der Fahrer ließ sich von seinem Beifahrer durch den See lotsen. Dieser watete, rückwärtsgehend, durch die klebrige Masse. Er blieb an einem im Öl verdeckt liegenden dicken Baumstamm hängen und konnte sich vor dem auf ihn zurollenden Wagen nicht mehr in Sicherheit bringen. Der Wagen fuhr über seine Beine und verletzte ihn schwer. Es gelang dem Fahrer, den Wagen auf die andere Seite zu bringen. Erst dann konnte er sich um seinen verletzten Kameraden kümmern. Er zog ihn aus dem See und hob ihn in die Fahrzeugkabine:
Der Verletzte fiebert und fantasiert. Seine Verletzungen sind tödlich. Der Fahrer redet verzweifelt auf ihn ein. Der Verletzte meint, in Paris zu sein. Er geht durch eine Straße. Auf einer Seite dieser Straße ist ein Bretterzaun. Diese Straße kenne ich auch, sagt der Fahrer. Der Verletzte will wissen, was sich hinter dem Bretterzaun befindet. Daraufhin sagt der Fahrer: Nichts! Sein Kumpel stirbt.
Diesen Dialog machte unser Vikar zum Thema einer Religionsstunde. Das Nichts wollte er nicht gelten lassen. Nach dem Tod existieren wir in einer anderen Form weiter, so seine Aussage. Und er diskutierte mit uns über Glaubensfragen. Er empfahl uns, dass wir uns diesen Film ansehen sollten. Das taten wir auch. Ich muss zugeben, dass ich diesen Film mehrfach gesehen habe. Und ich fieberte immer wieder diesem Dialog entgegen. Dabei musste ich an die Religionsstunde denken. Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist aber stärker als Wissen. Das habe ich in dieser einen Stunde gelernt und in meinem Inneren aufbewahrt. Meinen Religionslehrer habe ich nach der Schule ein- oder zweimal wiedergesehen. Danach nicht mehr. Vergessen habe ich ihn nicht.
Von dem Film habe ich eine Video-Kopie. Ich sehe ihn mir gelegentlich an, und ich durchlebe dann noch einmal die Religionsstunde. Ich bin dann wieder 16 Jahre alt und neugierig auf die Zeit, die vor mir liegt. Und ich möchte gerne erfahren, was hinter der Mauer ist.
Lehrer-Lehrer!
von Fritz Schukat aufgeschrieben und ergänzt 2006/2012
Während der Schulzeit hat wohl jeder 'einzigartige' Lehrer gehabt. Würde man die Geschichten, die sich um die Lehrer-Originale ranken, zusammentragen, es gäbe sicher viel zu lachen.
Angeregt durch ein nettes Gespräch mit Klassenkameraden möchte ich ein paar humorige Begebenheiten zu diesem Thema beitragen.
Direx M.
Unser Direktor, schlicht Direx ohne weiteren Namenszusatz genannt, war ein gut aussehender Mann, der stets mit tadellosem Anzug und Krawatte gekleidet durch das Haus lief und schon durch seine tiefe Stimme Respekt einflößte. Er unterrichtete zwar auch, aber nur in den oberen Klassen, ganz selten mal in der 10. oder 11. Klasse und wenn, dann eigentlich nur, um einen kranken Kollegen zu vertreten. Dass er auch temperamentvoll sein konnte, haben wir während solcher Vertretungsstunde erlebt, die auch deshalb in Erinnerung blieb, weil es dazu noch eine kleine Fortsetzung gab.
Wegen Renovierungsarbeiten mussten wir ein paar Tage in den Chemieraum ausweichen. Dort gab es einen langen Experimentiertisch, dessen Oberfläche mit Asbest ausgelegt war. Der Tisch war auch mit dem Boden fest verschraubt, weil es dort Gas- und Wasseranschlüsse gab. Die Stuhlreihen waren wie im Theater angeordnet, d.h., auch von den hintersten Plätzen konnte man noch gut sehen.
Auf dem Stundenplan stand Englisch, aber die Lehrerin war krank, also sprang der "Direx" ein. Der wollte wohl den planmäßigen Unterrichtsstoff nicht stören und brachte deshalb ein Reclamheft mit einem Text von Shakespeare mit, aus dem er nach einigen Einleitungen vorlas, und wir mussten das dann übersetzen. Zum Schluss war er so in Rage, dass er mit seinen Kreppsohlenschuhen, die damals hochmodern waren, auf den Tisch sprang und breitbeinig mit Stentorstimme irgendeine dramatische Stelle deklamierte. Natürlich riss uns diese Darbietung so mit, dass wir applaudierten. Und dann klingelte auch schon die Glocke zur Großen Pause.
Was der Chef nicht mehr sah, dafür aber wir, waren seine Fußstapfen auf dem grauen Asbestbelag, die er mit den Kreppsohlen dort 'hinterlassen' hatte. Natürlich wurden sie nicht entfernt! Dass wir uns diebisch auf die nächste Unterrichtsstunde freuten und die Bemerkungen des Lehrers, der diese "Beschmutzung" beanstanden würde, kann man sich sicher denken!
Wir hatten anschließend "Mathe". Der Lehrer, Dr. D., war ein kleiner, verwachsener älterer Mann mit einem ungeheuer großen Kopf und hoher Stirn, um nicht zu sagen Halbglatze. Die noch vorhandenen schütteren Haare waren sorgfältig nach hinten gekämmt und wuchsen in den Kragen hinein - ein Original. Er hatte eine große Brille auf, sah aber immer über den Rand, denn er konnte wegen seiner Verwachsungen weder aufrecht gehen noch stehen. Um die Schüler besser zu sehen, setzte er sich meist auf den Tisch, den er mit Hilfe eines hölzernen Fußtrittes relativ mühelos erklimmen konnte. Er hatte dicke breite Lippen, die ein wenig herunterhingen und dadurch eine so charakteristische Aussprache, dass er von einigen gewitzten Schülern fast perfekt imitiert werden konnte, d.h. eigentlich blubberte er. Kurz nachdem es zur nächsten Stunde bimmelte, kam er den Gang entlang geschlendert. Sein Laufstil war wegen seiner Behinderung so typisch, dass er selbst von den unbegabtesten Schülern nachgeahmt werden konnte. Der "Türschließer" knallte die Tür zu und begab sich an seinen Platz. Dr. D. erklomm nun wie gewohnt seinen Sitzplatz auf dem Tisch und erblickte sofort die Fußabdrücke. Er zog die Stirn in Falten und blubberte barsch: "Welches Ferkel hat denn das gemacht?" Wie auf Kommando kam dann mehrstimmig, "Das war unser Chef, der Direx!" Schmunzelnd relativierte „Dokterchen“ sofort seine Aussage und bemerkte süffisant: "Na dann hab ich nichts gesagt!" Unter allgemeinem Gelächter wurde dann der Tisch gereinigt.
Dr. D. hatte auch immer ein paar witzige Sprüche auf Lager, leider habe ich fast alle vergessen, einen aber habe ich behalten, weil ich ihn gut fand: "Mit der Mathematik ist es wie mit dem Klavierspielen, vom bloßen Zuhören lernt man nichts!" Wie wahr!
An einen anderen, recht derben "Schulspaß" erinnere ich mich ebenfalls noch. Wenn Abitursprüfungen anstanden, bedeutete das für uns immer verkürzten Unterricht und meist auch ohne Lehrer. Aber wir mussten zum Unterricht erscheinen, denn ansonsten lief alles "as usual!" Die Lehrerkonferenz tagte hinter verschlossenen Türen, dort wurden dann die Gesamtnoten und die Bemerkungen beschlossen. Aber meistens wussten die Abiturienten, dass ihnen nichts mehr geschehen konnte. Das muss wohl damals ihren Übermut beflügelt haben. Wir Jüngeren erfuhren nur, dass etwas Außergewöhnliches vorbereitet wurde, was es war, blieb bis zur letzten Minute geheim. Aber dann wurde unter lautem Grölen der kleine Messerschmitt Kabinenroller der Bio-Lehrerin in die erste Etage hoch getragen und vor das Lehrerzimmer gestellt. Weil wir uns dann alle so schnell wie möglich verzogen, mussten die Lehrer schließlich das kleine Gefährt selber runtertragen. Es soll ziemlich viel geflucht worden sein! Übrigens die Lehrer kamen damals fast alle genau wie wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Ein Auto hatten zu dieser Zeit - also etwa 1951/52 - nur die allerwenigsten Lehrer.
Eines der witzigsten Schulbilder, die ich kenne, durfte jemand von unserem Lateinlehrer schießen. Er war fast immer zu einem Spaß bereit, wenn er nicht "zu derb" war. Wir nannten ihn gern unseren "Magister maximus". Unter diesen Worten, die schnell an die Tafel gekliert wurden, fläzte er sich an den Lehrertisch und ließ sich für die Nachwelt ablichten. Das Bild ist etliche Dutzend Male abgezogen worden. Wir haben auf dem Goldenen Abitreffen, das wir im April 2005 feierten, genau dieses Bild wieder herzlich belacht - und es war in den meisten der Foto-Alben, die wir uns gegenseitig zeigten, zu finden!
Da „Magister maximus“ noch lebt - er ist jetzt etwa 91 Jahre und kommt regelmäßig zu unseren Klassentreffen - hat er natürlich weiterhin alle Rechte an seinem Bild und müsste erst befragt werden, wenn wir es hier veröffentlichen würden. Vielleicht ergibt sich in den nächsten Monaten ein entsprechendes Gespräch, dann könnte dieses einmalige Bild hier zu sehen sein! Um Geduld wird gebeten.
Meine ersten Schuljahre
von Fritz Schukat ergänzt 22.06. 2010
Ich wurde im Herbst 1942 eingeschult. Weil ich im Dezember Geburtstag habe, war ich zu dieser Zeit schon fast sieben Jahre alt. Das ist an sich nicht besonders erwähnenswert, aber aus unserer Straße wurde auch ein kleiner Junge eingeschult, der noch nicht ganz sechs Jahre alt war und das fand ich damals ziemlich ungerecht. Dass ich mich nach dem Krieg mit Manfred R. prächtig verstand und wir ganz dicke Freunde wurden, stand damals noch nicht auf dem Tapet.
Wir waren 43 Knaben. Unser Lehrer war noch von altem Schrot und Korn, kurz geschnittener, schlohweißer Kinnbart, weiße Haare, tadelloses Hemd mit weißem Stehkragen, also ein Bild von Lehrer und: er hatte einen kleinen Zeigestock, mit dem es auch mal kurz was auf die Finger gab! Wenn ich mir unser erstes Klassenbild genau ansehe, dann meine ich, er war mindestens schon 70 Jahre alt. Eigentlich eine unrealistische Vorstellung und doch könnte es so gewesen sein, denn die jungen Männer waren ja zu der Zeit fast alle schon im Krieg.
Unsere Schule hieß einfach nur „Rütlischule“ nach dem Namen der Straße, an der sie stand. Die Rütlistraße war eine sehr kurze Straße. Dort gab es eigentlich nur die Schule. Das Grundstück an der Ecke Weserstraße. war seit ewigen Zeiten eine bereits ausgehobene Baugrube, vorbereitet für drei bis vier dieser typischen Berliner Wohnhäuser, die dort schon in den zwanziger Jahren hätten hingebaut werden können. Aber der Zeitlauf hatte dies wohl verhindert: Inflation - Arbeitslosigkeit – Vorkriegszeit und nach 1939 wurde ja sowieso nicht mehr gebaut. Also entstanden dort Kleingärten, mitten in der Großstadt - ein merkwürdiger Anblick, aber wir waren ja nichts anderes gewöhnt.
Berlin wurde schon 1942/43 massiv von den Alliierten bombardiert. Der Schulunterricht litt darunter. Ein knappes Jahr später noch vor den großen Ferien wurden wir evakuiert, d.h. im Zuge der Maßnahmen, die die Behörden zum Schutz der Zivilbevölkerung veranlassten, wurden Familien mit ihren Kindern in weniger gefährdete Gegenden verschickt, die sie sich anfangs sogar noch selbst aussuchen konnten.
An den Ablauf des Schulunterrichts in der ersten Klasse habe ich kaum eine Erinnerung, auch nicht an die Schulzeit während der Evakuierung. Wir hatten dort nur noch wenige Monate Unterricht. Schon Mitte 1944 kamen Flüchtlingstrecks durch unser Dorf, da wurde die Schule zu einer Notunterkunft umfunktioniert, und wir Kinder hatten bis auf weiteres schulfrei. Allerdings haben wir in dieser Zeit dennoch weiter Schreiben, Lesen und Rechnen gelernt, denn die Mütter waren angehalten, mit ihren Kindern weiter zu üben.
Als wir nach Kriegsende wieder nach Berlin zurückkamen, wurde ich im Spätherbst 1945 in die vierte Klasse „gesteckt“, wo ich dem Jahrgang nach eigentlich auch hingehörte. Durch den ausgefallenen Unterricht war ich nicht sonderlich benachteiligt, denn es ging ja allen Kindern so.
Die Rütlischule diente damals noch für längere Zeit als Lazarett oder Hilfskrankenhaus, so dass wir dann in einen Schulkomplex am Hermannplatz umgeschult wurden. Mitte 1946 konnten wir uns für den Wechsel an eine Oberschule bewerben. Die Oberschulen waren damals noch schulgeldpflichtig, monatlich kosteten sie 20 „Reichsmark“. Wenn auch das Geld damals nicht viel wert war, ich hatte zunächst Bedenken, ob meine Eltern das würden aufbringen können. Aber als sich Klassenkameraden bewarben und angenommen wurden, die nach meiner Meinung „viel blöder als ich“ waren, packte mich der Ehrgeiz. Ich wusste, dass kinderreiche Familien eine Ermäßigung bekamen und erfuhr, dass für mich (wegen meiner beiden Schwestern) lediglich 12 RM monatlich fällig werden würden. Also machte ich die Aufnahmeprüfung für Nachzügler und bestand sie!
Zu Hause gab es natürlich Ärger, aber ich hatte alles auf eine Karte gesetzt: meine Tante aus Amerika hatte kurz zuvor in einem Brief jedem Kind eine Ein-Dollarnote geschickt und ich wusste, bei der Sparkasse bekam man dafür 96 „Reichsmark“! Das war mein Schulgeld für die kommenden 8 Monate. Was danach käme, würde man schon sehen, denn besonders fleißige Schüler konnten auch befreit werden, darauf spekulierte ich natürlich.
Aber es kommt ja immer anders als man denkt. Die ersten freien Wahlen nach dem Krieg bescherten der Stadt einen sozialdemokratischen Magistrat, der u.a. auch die endgültige Schulgeldfreiheit beschloss.
„Mein“ Dollar war zu dieser Zeit aber schon umgetauscht. Für den Rest konnte man sich damals „nicht einmal ’nen Appel und ’n Ei“ kaufen!
Leider.
Einschulung 1964

1. Klasse der Rhener Schule 1964
von Hans Meier
Ich kann mich noch gut an meine Einschulung erinnern. Mit den Schultüten warteten wir Kinder vor der Quickborn-Heider Waldschule, bis es endlich losging. Wir wurden dann in einen der 3 Klassenräume im Altbau der Schule geführt. Es gab eine Darbietung von schon größeren Schülern, es wurden Reden gehalten, und es gab ein Glas Milch mit einem Stück Kuchen. Ich weiß es noch wie heute: es gab Bienenstich.
Am nächsten Tag hatte ich meine erste Schulstunde. Wir sollten ein Vogelnest malen, vorher hatte man uns Kindern gezeigt, wie ein Eichelhäher im Nest saß. Na, den kannte ich schon, und überhaupt, ein Vogelnest malen, wenn so die Schule ist, dachte ich blauäugig, dann war das hier ja baby-einfach. Kurz darauf musste ich die Schule aber wieder verlassen. Meine Mutter wollte nach Henstedt-Rhen umziehen. Also kam ich in die erste Klasse der Rhener Schule. Dort ging es mir aber nicht so gut, in den Pausen wurde ich häufig von anderen Mitschülern geärgert, und darum ging ich mit Widerwillen in diese Schule.
Mittlerweile hatte sich der Umzug nach Henstedt-Rhen aber wieder zerschlagen, und darum blieb mein Elternhaus in Quickborn Heide. Da ich mich ja eingelebt haben sollte, musste ich weiterhin erstmal dort zu Schule gehen. Bis eines Tages ein Vorfall alles ändern sollte.
Wieder einmal in der großen Pause wurde ich gepiesackt, geschubst oder in den Hintern getreten. Meine erneute Beschwerde an die Pausenaufsicht hatte keinen Erfolg. Die Lehrerin meinte jedes Mal, ich solle mich wehren.
Gut gesagt, aber die beiden Zwillingsschwestern waren älter als ich, und in den Pausen hatten die mich auf dem Kieker. Ich war auf der Flucht, die Schwestern rannten hinter mir her. In meiner Verzweiflung, da ich sie nicht abschütteln konnte, sah ich ein kleines Steinchen am Boden liegen. Während des Laufens bückte ich mich nach dem Stein, und drehte mich auch während des Laufens um, und warf den Stein blindlings ohne zu zielen nach hinten. Volltreffer, ein Aufschrei kam von einem der beiden Mädchen.
Doch nun bekam ich Angst, das Mädchen stammelte zu den anderen Kindern, die sich um sie gebildet hatten, ich hätte ihr den Stein an den Kopf geworfen, und Blut war auch zu sehen. Später erzählte mir meine Mutter, dass das Mädchen ein Loch im Kopf hatte.
Die Kinder wollten mir nun an den Kragen. Mit aller Kraft lief ich so schnell ich konnte vom Schulhof weg, die anderen Kinder hinter mir her.
Hinter der Schule war ein Spielplatz mit einigen Geräten und einem Sandkasten. Dahinter gab es eine große Graswiese. Diese Wiese war viele Jahre nicht gemäht worden. Im Laufe der Zeit waren die Grasbüschel ziemlich hoch geworden und hatten sich ineinander verwoben.
Genau zwischen diesen Büscheln schlängelte ich mich wie eine Schlange unten durch und hinein.
Mittlerweile kam eine Horde Kinder um die Ecke auf dem Spielplatz, einer hatte noch gesehen, wie ich mich irgendwo im Gras versteckte, und so suchten die Kinder die Wiese ab.
Unter dem Gras sah ich, wie einige Kinder auf mich zukamen. Ich dachte schon, jetzt haben sie dich entdeckt, denn einer sah mich scheinbar an. Doch er schien mich nicht zu sehen und ging an mir – o Wunder - vorbei.
Als es die Kinder aufgegeben hatten, mich zu suchen, ging ich einige Zeit später, nach Schulschluss, wieder in die Schule, weil mein Ranzen ja noch dort war. Allerdings hatte man schon auf mich gewartet, sperrte mich in meine Klasse ein, und ich sollte eine Stunde nachsitzen. Einige Minuten waren vergangen, ich empfand das als sehr ungerecht, ich hatte mich doch nur gewehrt. Ich öffnete das Fenster, kletterte mit meinem Ranzen in die Freiheit und ging nach Hause.
Nun, das hatte natürlich ein Nachspiel. Kurzum, ich brauchte nicht mehr in Henstedt-Rhen zur Schule zu gehen. Die Waldschule hatte mich nun 1965 wieder.
Talentiert
von Uwe Neveling
Eine ruhige Kugel schieben kam für mich nicht infrage. Ich probierte es mit Fußball. Ich merkte aber bald, dass es in diesem Sport viel zu ruppig zuging. Ich bevorzugte doch mehr das körperlose Spiel. Mit Hallenhandball konnte ich daher auch nichts anfangen. Ging es ebenda doch noch viel härter zu. Da ereilte mich der Ruf des Schwimmvereins Blau-Weiß. Schon mein Vater war Mitglied in diesem Verein gewesen und hatte es dort zu einem Spitzensportler gebracht. Die Sportlerkarriere meines Vaters wurde durch den Krieg je beendet.
An die Leistungen meines Vaters kam ich nicht heran. Es hemmte mich auch, dass ich immer mit meinem Vater verglichen wurde. Mein Freund Otto brachte mich auf eine Idee. „Probier es doch mal als Kanute. Ich nehme dich mit auf eine Wanderfahrt. Du kannst von mir auch einen Einer-Kajak kriegen“ sagte er zu mir.
Als wir auf dem Bahnsteig standen und uns von einer heftig dampfenden Lok einnebeln ließen, bekam ich weiche Knie. Ob das wohl gut gehen würde? Fragte ich mich immer wieder. Otto machte mir Mut. „Du wirst schon nicht absaufen“ sagte er zu mir, „im Wasser kannst Du nicht tief fallen. Bei einem Flieger ist es weit gefährlicher. Der schlägt – wenn er Pech hat – hart auf.“ Otto liebte gefühllose Vergleiche. Dabei war er selbst ein einfühlsamer Mensch. Wir wuchteten unser Bootsgepäck in den Gepäckwagen und nahmen dann weiter hinten unsere reservierten Plätze ein.
Es wurde eine kurzweilige Fahrt. Über Hamburg ging es nach Lübeck-Travemünde und mit der Fähre nach Helsinki. Von dort fuhren wir mit der Bahn nach Kuopio. Hier bauten wir unsere Boote zusammen und machten uns auf nach Savonlinna. Die Sportart Kajakwandern gefiel mir. Ich trieb mein Boot mit kräftigen Schlägen voran und merkte bald alle Muskeln. Ich saß im Boot und musste mit dem verlängerten Rücken, den Oberschenkeln und den Knien das Boot ausbalancieren. Mit Unterstützung des Oberkörpers und der Armmuskulatur tauchte ich die verdrehten Paddelblätter ins Wasser und sorgte so für Vortrieb. Bald taten mir alle Glieder weh. Ich verspürte aber keine Schmerzen im eigentlichen Sinne. Es war wohltuend, meinen ganzen Körper zu spüren. Ich wusste jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg war. Für diesen Sport konnte ich mich begeistern. Und ich blieb dabei. Es gab noch viele Wanderfahrten, die auch nicht immer ungefährlich waren. Eine gute Vorbereitung und ein austrainierter Körper verhinderten Schlimmeres. Ich habe alles überlebt, und wenn ich mich mit gleichgesinnten Freunden treffe, erinnern wir uns an die vergangene schöne Zeit mit Wehmut. Man ist sich einig darüber, dass Talente frühzeitig entdeckt werden müssen. Nur dann schafft man sich eine Erlebniswelt, die ein Leben mit Inhalt füllt.
Schule damals
von Rolf Rehder
Im Jahre 1931 wurde ich eingeschult, und zwar in die Grundschule, damals Volksschule, in der Meerweinstraße in Hamburg-Winterhude. Das war zu Ostern, weil damals das Schuljahr nach den Osterferien begann.
Die Schule befand sich in einem großen, mehrstöckigen Gebäude mit zwei voneinander getrennten Teilen und jeweils zwei voneinander getrennten Eingängen. Links für Jungen - damals Knaben - und rechts für Mädchen. Diese Trennung war seinerzeit allgemein üblich. Es gab nur wenige Schulen mit gemeinsamen Unterricht. Die Trennung wurde auch deutlich gemacht mit einer Trennungslinie auf dem Schulhof, um zu verhindern, dass Jungen und Mädchen zusammen-kommen konnten.
Die Lehrer waren überwiegend Männer. Ich erinnere mich nur an eine Lehrerin, bei der wir alle nur „Schönschreiben“ üben mussten. Anfangs schrieben wir auf Schiefertafeln mit einem Griffel und Schwamm. In meiner Klasse saßen wir mit 32 Jungen auf den damals üblichen Holzbänken. Die Unterrichtsfächer waren etwa die gleichen wie heute.
Zeugnisnoten gab es anfangs von eins (1) bis fünf (5), später bis sechs (6). Im Jahre 1935 kam ich dann auf das Gymnasium, damals „Oberrealschule“ und später „Oberschule für Jungen“. Diese Bezeichnung zeigt, dass auch dort die strikte Trennung von Jungen und Mädchen galt.
Auf der Volksschule hatten die Klassenjahrgänge Bezeichnungen. 8., 7., 6. und 5. Klasse. Auf der Oberschule gab es noch die traditionellen Bezeichnungen: Sexta, Quinta, Quarta, Tertia, Sekunda und Prima. Dort hatten wir zwar keine Schuluniformen, aber Schirmmützen, die jahrgangsweise unterschiedliche Farben hatten. Dunkelblau, dunkel-grün, dunkelrot, hellblau, hellgrün, hellrot, gelb und weiß. Das hörte aber etwa in den vierziger Jahren auf. Dann trugen wir die Uniformen der Hitlerjugend, die allerdings nicht ständig getragen wurden.
Einer älteren Familienchronik konnte ich entnehmen, wie das Schulwesen sich vor einigen Generationen darstellte. Es handelt sich dabei um eine Dorfschule im Landkreis Stade etwa in den Jahren 1860/1870. Die Schule hatte nur eine Einheitsklasse für alle Jahrgänge und auch nur einen Lehrer. Im Sommer waren die älteren Schüler vom Unterricht befreit, weil sie den Bauern bei der Feldarbeit helfen mussten. Das betraf jedenfalls die Kinder, deren Väter bei einem Bauern Dienst taten. Die Arbeit - Ernten, Pflügen und Vieh hüten - dauerte vom frühen Morgen bis zum Abend.
Ausführliche Informationen über die Schule damals bietet das Schulmuseum in Hamburg-St. Pauli in der Seilerstr. 42.
Diese Geschichte hat uns Rolf Rehder, Heimbeiratsvorsitzender im DANA Pflegeheim Buchenhof in Quickborn im Jahre 2008 zur Verfügung gestellt.
Fritz Schukat, 23.05.201
Schulzeit
von Edith Kollecker
Die Schulzeit ist die schönste Zeit, sagt ein Sprichwort! Ich kann das leider nicht bestätigen. Mein erster Schulweg in Pommern 1941 war ca. 3 Kilometer lang und im Winter für ein sechsjähriges, kleines, dünnes Mädchen kaum zu bewältigen. Der Tornister war mir zu schwer, in der heutigen Zeit ist er viel weniger bestückt. Ich hatte eine Schiefertafel, einen Griffelkasten, die Fibel, einen nassen Schwamm und einen trockenen Lappen, mehr war zwar nicht drin, aber er war trotzdem schwer. Meine Schwester Lieschen brachte ihn mir oft mit dem Fahrrad hinterher. Dann versuchte man, mich mit Lebertran zu Hause und später auch in der Schule etwas aufzupäppeln. Ob gerade der Lebertran dazu beigetragen hat, kann ich nicht sagen, jedenfalls konnte oder musste ich meinen Ranzen später selber tragen.
Im Sommer war der Weg abwechslungsreich. Mal nahmen wir die Kirschenallee oder die Apfelallee, je nach Jahreszeit oder Nachfrage. Einen Schritt ins Gebüsch und es gab Erdbeeren, Himbeeren oder Blaubeeren. Auf dem Heimweg waren auch schon mal zwei Stunden angesagt. Die Freude der Eltern uns wieder zu sehen, hielt sich in Grenzen. Ich erinnere mich noch an meine Einschulung. Ich wurde, im Arm die Schultüte, auf dem Fahrradgepäckträger von meiner Schwester mitgenommen. Auf den Sandwegen war das eine heikle Sache. Wir mussten zwischendurch immer absteigen und laufen, meine Schwester fluchte und ich heulte, weil ich Sand in meinen neuen Schuhen hatte. Wir schafften es trotzdem, rechtzeitig zur Feier anzukommen. Man setzte mich neben zwei Kindern, die ihren Namen sagten.
„Ich heiße Erna Pommerening“ und der Junge, „ich heiße Lothar Beling!" Wenn man das E in die Länge zieht, klingt es schön und ich war so fasziniert, dass der Lehrer mich erinnerte, nun auch meinen eigenen Namen zu sagen. Es war kein guter Start für mich, so in ein neues Leben einzusteigen. Erinnern kann ich mich noch an die Hitler-Lieder, die wir zu Schulbeginn singen mussten. Singend und Fähnchen schwingend wurde Hitlers Geburtstag gefeiert. Schöner war jedenfalls der Geburtstag unseres Lehrer. Der Rohrstock blieb dann in der Ecke stehen, denn wir brachten ihm Geschenke, alles selbst gepflückt, aus dem Garten oder aus dem Wald. Ende 1944 gab es oftmals schulfrei und ab Januar 1945 war die Schule ganz geschlossen und diente nur noch als Unterkunft für die Flüchtlinge aus dem Osten. Als am 1. März 1945 unsere eigene Flucht begann, hatte ich schon vier Jahre Schulzeit hinter mir.
Nach der Flucht bin ich in den letzten Schuljahren in Petersdorf zur Schule gegangen. Wir wohnten ganz am Anfang des Dorfes auf Gut Lutz. Und wieder war es eine Stunde Fußmarsch. Der Schulweg war aber sehr interessant. Die Straße verlief an einem kleinen Fluss entlang, so dass wir im Sommer auf dem Heimweg oft im Fluss gingen. Alle paar hundert Meter war ein Bauernhof mit schulpflichtigen Kinder. Den Anfang des Weges machte ich und die anderen Kinder kamen dann dazu. Ein Junge wohnte abseits der Straße, da er im Dunkeln nicht zu sehen war, jodelte er und wir wussten dann, er ist im Anmarsch. Es bildeten sich altersgemäß kleine Gruppen. Wir ergänzten gegenseitig unsere Hausaufgaben, lernten unterwegs alle Gedichte und - was sehr wichtig war - das 1x1. Jedes Kind sagte eine Zahl, kam dann beim 1x5 die 5 oder die 10, sagten wir Hopp. Passten wir nicht auf, durften wir nicht weiter mitspielen. Zum Schluss war dann nur noch ein Kind, das das 1x1 runterrasselte und die Schule war erreicht.
Oft hat uns der Lehrer wegen unserer Pünktlichkeit gelobt. Die Kinder, die in der Nähe wohnten, kamen erst beim Klingeln angerannt. Unser Lehrer, Herr Lange, auch nicht mehr jung, hatte vier Klassen in einem Klassenraum zu unterrichten. Er hatte aber alles im Griff. Drei Klassen mussten ruhig alleine arbeiten. Einen Aufsatz schreiben, rechnen, Schönschrift und lesen, und anschließend seine Fragen beantworten.
Mit der 4. Klasse beschäftigte er sich dann persönlich. Obwohl ich das 1x1 aus dem „ff“ konnte, waren seine Kettenrechenaufgaben für mich ein Gräuel. So verging ein Jahr nach dem anderen, und Herr Lange hatte fast allen Kindern zu einem einigermaßen guten Zeugnis verholfen. Als das 9. Schuljahr eingeführt wurde, stellte man uns Tische und Stühle in die letzte Reihe. Wir waren alle etwa 15 Jahre alt und benahmen uns auch so, sehr albern. Damit unser Ofen warm wurde, mussten wir zum Torfringen gehen. Auf einem Leiterwagen wurden wir ins Moor gefahren, um die Torfsoden zu einem Turm zu stapeln. Herrlich, wir hatten viel Spaß.
Eine Geschichte fällt mir noch ein. Jeden Tag kam ein Junge in unserem Alter, setzte sich in die erste kleine Bank dicht am Ofen. Er packte seine Tasche aus, ging mit uns in den Pausen nach draußen und am Ende des Unterrichts, genau wie wir, nach Hause. Es hat sich niemand mit ihm beschäftigt, weder wir, noch der Lehrer. In der heutigen Zeit hätte man ihm zu einem einigermaßen normalen Leben verholfen. Bei unserem 20-jährigen Klassentreffen war er nicht mehr anwesend, etwas beschämt wurde aber an ihn gedacht.
Unsere Flucht dauerte 6 Wochen und am 15. April 1945 waren wir in dem Dorf Benthullen* angekommen. Ich kam bei dem Bauer Wilms unter und dort erlebte ich auch das Ende des Krieges. Wir waren der letzte Bauernhof an der Grenze nach Petersdorf. Bei uns waren noch deutsche Soldaten stationiert. Der nächste Hof, ein kleines Gut, war 3 km entfernt und dort waren schon die Alliierten. Ein Fluss, dessen Brücke gesprengt war und die Straße, auf der lauter Bäume lagen, trennte uns von ihnen. Jeden Abend wurden wir beschossen und beim ersten Schuss rannten wir ins Moor. Dort hatte der Bauer uns eine Höhle gebaut. So vergingen die Tage, bis der Krieg zu Ende war. Dann begann auch wieder die Schule. Ich besaß weder Ranzen noch Bücher oder Hefte. Ein Bleistift, ein paar Blätter, das musste für den Anfang reichen. Erinnern kann ich mich nur an einen sehr jungen Lehrer. Er begleitete täglich einen Schüler nach Hause zu dessen Eltern, um ein warmes Mittagsessen zu bekommen. Auch mich nahm er eines Tages auf dem Fahrrad mit, um bei uns zu essen. Ich hatte ein sehr ungutes Gefühl, denn unsere Bauersleute machten um die Zeit ihren Mittagsschlaf. Mein Essen stand dann immer in der Röhre. Doch meine Angst war unbegründet, die Bauersfrau hat uns mit einem guten Essen empfangen und sich sehr gut mit ihm unterhalten.
Nach ein paar Monaten kam mein Vater aus der Gefangenschaft, suchte sich Arbeit auf dem kleinen Gut Lutz und holte mich nach. Jetzt hatte ich wieder anderthalb Schuljahre vollbracht.
verfasst im Mai 2010
*bei Wikipedia liest man folgendes:
Benthullen ist ein Dorf der Gemeinde Wardenburg im Landkreis Oldenburg im nordwestlichen Niedersachsen. Dieses Dorf gibt es erst seit 1934. Noch 1933 war Benthullen ein Sumpfgebiet. Als erster Schritt zur Trockenlegung des Gebietes, in dem heute Benthullen liegt, wurden Gräben gezogen. Dies geschah durch den Freiwilligen Arbeitsdienst. Die Zahl der Einwohner hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Nach 1945 wuchs Benthullen hauptsächlich durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den Ostgebieten.
Lehrers Geburtstag
von Edith Kollecker
Aus unserem kleinen Ort Streckenthin gingen ca. sieben Kinder verschiedenen Alters ins Nachbardorf Gülz zur Schule. Der Schulweg war 3 km lang. Wir waren vielen Versuchungen ausgesetzt, denn je nach Jahreszeit nahmen wir die Äpfel, Birnen, oder Kirschen von den Alleen an unserem Schulweg mit. Das nahm uns unser Lehrer Herr Zylow übel, weil wir immer mit schmutzigen Händen dort ankamen. Alle Kinder lachten, wenn es hieß, „Die Streckenthiner Kinder: die Hände vorzeigen!“
Manchmal gab es was mit dem Rohrstock auf die Finger, worauf die Gülzer Kinder schon warteten. Doch am lustigsten fanden sie es (dann standen alle am Fenster), wenn wir auf den Hof geschickt wurden, zum Händewaschen. Der Größte von uns musste pumpen!
Einmal im Jahr waren wir die Sieger, an Lehrers Geburtstag. Rings um unseren Ort waren große Wälder, da wuchs alles sehr üppig. So gingen wir einen Tag vorher los, um Blaubeeren, Brombeeren und Pilze zu suchen, diese schenkten wir dann dem Lehrer zu seinem Geburtstag. Der schickte uns damit zu seiner Frau. Die gab uns dafür ein großes Stück Streuselkuchen und alle anderen Kinder guckten uns beim Essen neidisch zu!
Im Herbst, wenn die Bäume kahl waren, hörte es mit den schmutzigen Händen von allein auf.
Als ich das neulich meiner Schwester erzählte, sagte sie: „Das haben wir ja schon gemacht,“ und sie ist zehn Jahre älter als ich. Alle meine Geschwister haben bei Lehrer Zylow das Lesen und Schreiben gelernt und wir waren sieben an der Zahl.
Die Älteste war schon fünfzehn Jahre alt, als ich geboren wurde!
gespeichert am 29.09.2003
Hausaufgaben – Kartoffelkäfer
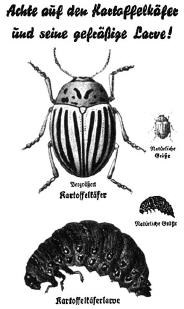
von Annemarie Lemster
Es muss 1948 gewesen sein. Ich besuchte die vierte Klasse der Mädchenschule in Sarstedt bei Hannover. Unser Unterricht lief nach dem Krieg langsam wieder normal ab, wenn auch immer noch viele Lehrer fehlten und unsere Schülerzahl in einer Klasse oft noch über 50 war. Es gab wieder Schreibhefte und der Unterrichtstoff brauchte nicht mehr von der Tafel abgeschrieben zu werden. So konnten die Hausaufgaben zu Haus mit Lehrbüchern erledigt werden.
Im Frühsommer dieses Jahres blieben die Bücher aber sehr oft in der Büchertasche, denn wir bekamen keine Hausaufgaben auf. Wir mussten uns stattdessen am Nachmittag mit einer leeren Konservendose an einem bestimmten Kartoffelacker zum Kartoffelkäfersuchen einfinden.
Zuerst wurde uns gezeigt, was Kartoffelkäfer sind. Wir erfuhren, dass diese gelben, schwarz gepunkteten Käfer ihre Eier unter die Blätter des Kartoffelstrauches legen, woraus dann die gefräßigen roten Larven schlüpfen. Haben diese sich einmal über so einen Busch hergemacht, fehlen die Blätter. Die Kartoffel in der Erde bekommt keine Nahrung mehr und geht ein. Nach diesem naturkundlichen Vortrag bekam jede Schülerin eine Reihe zugewiesen, die sie sorgfältig nach Kartoffelkäfern und Larven absuchen musste.
Wir Kinder waren nicht gerade traurig über diese Arbeit, ersparte sie uns doch die Hausaufgaben. Es war auch irgendwie ein Wettkampf unter uns Schülerinnen, jeder wollte doch eine volle Dose präsentieren. Wir fanden diesen kleinen Schädling auch schön, sah er doch wie ein gelber Marienkäfer aus, und erst die Larven! Dieses Rot war doch wunderbar! Warum ich mich aber vor den kleinen gelben Eierpaketen geekelt habe, ist mir bis heute ein Rätsel. Waren wir am Ende der Kartoffelreihe angelangt, bekamen wir eine neue zugewiesen.
Auch nach vielen Überlegungen ist mir nicht mehr eingefallen, was wir mit dem Inhalt unserer Dosen gemacht haben.
erstellt am 08.06.2009
Lernen, was ist das?
von Annemarie Lemster
In einem früheren Bericht habe ich schon erzählt, wie mein erster Schultag ausgesehen hat. Wir waren 80 Mädchen in einer Klasse. Dort standen vierzehn Bänke, auf jeder Seite sieben. Sechs Mädchen saßen nun in einer Bank und übten auf der Schiefertafel mit einem Griffel ein „O“, unser erster Buchstabe. Dann folgten weitere, bis wir „Oma“ schreiben konnten. Wie schön, ein ganzes Wort konnten wir nun von der Tafel ablesen. Lesebücher gab es im Herbst 1944 nicht. Der Lehrstoff wurde an die Tafel geschrieben und danach wurde gelernt. Mir gefiel es in der Schule immer weniger. Ein Grund war, ich musste wegen meiner Größe immer in die letzte Bank. Es sollte sich keine andere Schülerin hinter meinen Rücken verstecken können. Sollen die da vorne doch aufpassen, ich nicht, dachte mein Trotzkopf.
So verging mein erstes Schuljahr, na sagen wir mal, es verging eben.
In der zweiten Klasse sollte sich nun viel ändern. Wir bekamen einen Lehrer und die Kasse wurde geteilt. Mit vierzig Mädel war es schon angenehmer in der Schule. Leider herrschte in dieser Zeit großer Lehrermangel. Viele Lehrer waren aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen oder noch nicht. Unser Lehrer war aus der Pension zurückgeholt worden. Seine Unlust hatten wir recht schnell herausgefunden und machten sie uns zu Nutze. Da er Geigenspieler war, brauchten wir nur zu fragen: „Herr Propfe, können Sie schon wieder ein neues Lied?“, „Ja, wollt ihr es hören?“ Schon war der Unterricht gelaufen und für uns recht schnell zu Ende. Wer aber frech wurde, bekam auch schon mal Haue mit dem Geigenstock. Wer unaufmerksam war, musste vor die Tür, dann hieß es mit brummiger Stimme, „Laube, raus!“ Ich hatte viele Freundinnen und so blieb ich nicht lange allein draußen. Wir spazierten nun in der Stadt herum, denn rein durften wir erst wieder, wenn Schulschluss war. So vergingen zwei Jahre, in denen ich nicht viel lernte und mit meinem kindlichen Verstand dieses sogar gut fand.
In der vierten Klasse bekamen wir eine Lehrerin, oh toll, das wird sicher gut werden. Zu Haus erzählte ich von Fräulein Hanke, da rief Mutti: „Was, „Schlatsche“ hast du bekommen? Bei der hatte ich ja schon Unterricht!“ Es lagen dreiunddreißig Jahre dazwischen und den Spitznamen habe ich am nächsten Tag gleich voller Wonne mit in die Schule gebracht.
Am Anfang der vierten Klasse waren recht viele neue Mädchen in unsere Klasse gekommen. Wie sich herausstellte, waren sie alle sitzengeblieben. Nun gab es noch mehr Mädchen in der Klasse, die so groß waren wie ich. Auf der einen Seite fand ich dieses gut, aber dann wollte ich nicht mit den Sitzenbleibern verglichen werden. Dieses war wohl der Moment, wo mir langsam klar wurde, wenn man tüchtig lernt, kann man auch etwas. In meinem kleinen Gehirn kam diese Erkenntnis sehr spät an.
Später habe ich dann auch verstanden, warum so viele Mädchen zurückversetzt wurden. Es waren alles welche, die durch die Kriegswirren keinen oder nur sehr wenig Unterricht hatten, und sie gar nichts dafür konnten, das Schuljahr noch einmal zu wiederholen.
erstellt am 27.06.2010
Mit Gebrüll ins Schulleben
von Annemarie Lemster
2. April 1945, mein Tag der Einschulung. Ich kann nicht sagen, ob ich mich auf diesen Tag gefreut habe, aber etwas Besonderes war er für mich nicht. Er sollte aber etwas Besonderes werden und hat mich acht Jahre lang begleitet.
Wir hatten durch Bombenangriffe alles verloren, so war für mich auch kein Tornister von meinen Geschwistern mehr vorhanden. Ich bekam einen ausgebrauchten von einem Nachbarjungen, also einen Jungentornister. Damals hatten Jungen und Mädchen noch unterschiedliche Schultaschen. Bei den Jungen wurden sie unten zugeschnürt und bei den Mädchen auf halber Höhe. Dieses war für mich nicht so schlimm, aber schön auch nicht, und dass ich - wie viele andere - keine Schultüte bekam, war auch nicht so schlimm, ich hatte ja ein kleines Weidenkörbchen mit einem Apfel, ein paar Keksen und selbstgemachten Bonbons!
In der Schule. Mein erstes Klassenzimmer. Ausgerüstet mit allen Ermahnungen meiner Mutter, einer Tafel, einem Griffel in dem Tornister und einem Schwämmchen, das außen lustig hin und her schwang, betrat ich diesen Raum, in dem ich ab heute jeden Tag etwas lernen sollte. Dieser Raum wurde für mich zum Albtraum. Und das war schlimm. Zehn Reihen Bänke, an jeder Seite fünf. In einer Bank mussten immer acht Mädchen Platz nehmen. So waren wir 80 Kinder und hinter uns standen die Elternteile, die uns in die erste Schulstunde begleitet hatten.
Nun hörte ich den Satz, der mich acht lange Schuljahre immer wieder begleitete, „Du setzt dich mal nach hinten, sonst kann man sich ja hinter Deinem Rücken verstecken!" Was konnte ich dazu, dass ich immer die Längste in der Klasse war?
Es war schrecklich laut in der Klasse und es dauerte eine Weile, bis die Lehrerin alle Kinder und Erwachsene zum Schweigen gebracht hatte. Doch nun kam aus der anderen hinteren Bank ein Geräusch.
Ein Mädchen weinte.
Es wurde lauter und dann schrie dieses Mädchen: „Ich will hier raus.“ Ich war nun verunsichert und das war schlimm. Dieses Mädchen schrie die ganze Stunde mit nur kleinen Unterbrechungen. Immer wieder dieses „...ich will hier raus!“ und dann kam „Mama gib mir ein Taschentuch."
Was war das? Die Lehrerin dort vorn war die Mutter von diesem Mädchen!
Nun stand für mich fest, Schule muss etwas Schlimmes sein. Wenn das Kind einer Lehrerin so schrie, weil es in die Schule kam, konnte es nur so sein. Diese Antipathie gegen Schule und Unterricht hat sich acht lange Jahre gehalten, auch wenn es später sehr nette Lehrer gegeben hat. Mit der Einsicht von heute hätte ich damals sicher einige bessere Noten erreichen können.
Bei unserem Klassentreffen 1995 habe ich spontan die Sätze „Ich will hier raus“, und „Mutti gib mir ein Taschentuch!“ in die Runde gerufen.
Ruhe.
Dann riefen einige: „Else! - Mensch Annemarie, dass du das noch weißt!“
erstellt am 21.04.2004
Schulspeisung 1947
von José O. Probst erstellt am 03.03.2008
Nach dem Krieg sanken die Lebensmittelrationen in Deutschland unter das Existenzminimum. Besonders in den Städten hungerten die Menschen, denn wer hauptsächlich mit den Zuteilungen der Lebensmittelkarte auskommen musste, war schlimm dran. Auf dem Schwarzmarkt wurde „geschachert“, und mit restlos überfüllten Zügen fuhr man aufs Land, um etwas Essbares zu ergattern oder auf dem Tauschwege zu erlangen.
Unter dem Eindruck der schlechten Versorgungslage versuchten die Besatzungsbehörden, den Hunger und die Unterernährung der Kinder zu mildern. In Schleswig-Holstein führten die Briten Anfang 1946 die Schulspeisung aus Armeebeständen ein. Einen ganz entscheidenden Anteil an der Durchführung dieser Hilfsaktionen aber hatten ausländische Organisationen, wie z. B. die Quäker, CARE, die Schwedenhilfe und die Dänische Lebensmittelspende.
Die tägliche warme Mahlzeit für jeden Schüler bestand zunächst aus einer Milchsuppe. Außer der „berühmten“ Kekssuppe standen eine Schokoladen-, Haferflocken-, Graupen- und die Sojabohnensuppe auf dem Speiseplan. Später gab es auch gelegentlich mal Eintopfgerichte. Für die Anlieferung benutzte man Thermokübel, die Schätzungsweise 25-30 Portionen fassten. In unserem Klassenzimmer stand jedenfalls immer ein voller Kübel. Die Ausgabe des Essens erfolgte stets in der ersten Pause - abhängig vom Schichtunterricht - morgens oder nachmittags. So konnten die Lehrer wenigstens sicher sein, dass ihre Schüler während des Unterrichts etwas Warmes im Magen hatten. Für die Zuteilung der einzelnen Portionen in die vorhandenen Kochgeschirre wurde ein entsprechend großer Schöpflöffel benutzt. Viele Augen wachten argwöhnisch darüber, dass er auch immer randvoll war. Probleme dieser Art konnte es bei der beliebten Kekssuppe geben, denn nicht selten bestand diese aus noch festen ganzen Keksen. War auf diese Weise die gesamte Klasse - einschließlich Lehrer natürlich - versorgt, wurde die Restmenge als Nachschlag verteilt. Dafür gab es eine Strichliste, so dass sich jeder einmal zu den Glücklichen zählen konnte. Zum Schluss machten sich zwei Schüler daran, den Suppenkübel mit dem Esslöffel „auszukratzen“ - damit ja nichts umkommt. Auch das ging reihum.
Bis in das Jahr 1948 wurde das Schulessen auch am Sonntag ausgegeben. Den meisten Mitschülern war dafür kein Weg zu weit, und deshalb hatten wir fast immer eine volle Klasse.
Nach der Währungsreform verschwanden die Suppenkübel langsam aus dem Schulalltag. Wie so vieles, änderte sich auch bei uns die Schulspeisung. Bald gab es belegte Brote mit Wurst oder Käse, sowie ein Milchgetränk. Aber jetzt alles gegen eine - wenn auch geringe Bezahlung.
Mit großer Dankbarkeit sprechen wir auf unseren jährlichen Klassentreffen oft über die Schulspeisung, die uns half, die Hungerjahre zu überstehen.
Die Dorfschule
von Ellen Probst
Kiel gehörte mit dem Reichskriegshafen, seinen Marine-Einrichtungen und Werften frühzeitig zu den bevorzugten Zielen der britischen Bombergeschwader. Deshalb entschloss man sich schon 1940, die Schulkinder klassenweise im Rahmen der so genannten Kinderlandverschickung in Gebiete zu bringen, wo keine Angriffe zu befürchten waren. Selbstverständlich fuhren auch Lehrer und Betreuungspersonal mit.
Wir hatten die Möglichkeit, bei unseren Großeltern zu wohnen, die in einem Dorf nahe Büsum lebten. Dort ging ich dann auch in die Schule. Es war eine kleine Schule, sie hatte nur einen Klassenraum, in der alle 8 Schuljahre (ca. 50 Kinder) von nur einem Lehrer unterrichtet wurden. Das war mit Sicherheit nicht einfach, aber es funktionierte, auch dank der Unterstützung der "Großen", die mit uns jüngeren Schülern gelesen haben oder gelegentlich dass „1x1“ abfragten etc.
Inzwischen war es dann dem Lehrer möglich, sich gezielt um andere zu kümmern. Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, dass auch dort das Wissen für weiterführende Schulen vermittelt werden konnte. Es gab natürlich Fächer, wo alle zusammengefasst waren, z.B. "Musik", was fast immer "Singen" bedeutete, oder "Sport", der aus "Hoch- und Weitsprung, Laufen oder Ballspielen" bestand.
In dieser Schule war ich zunächst die einzige "Städterin" und unterschied mich in einem ganz deutlich von meinen Mitschülerinnen: Bubikopf und Hahnenkamm! Alle anderen Mädchen trugen Zöpfe. Ein paar Wochen später kamen zwei Schwestern dazu, auch aus Kiel, wie ich, und auch Bubikopf und Hahnenkamm. Wir wurden bewundert und beneidet, weil wir „eine Frisur" haben durften.
Es war eine schöne Zeit dort. Auf den Bauernhöfen gab es genug zu essen, die Nordsee war nicht weit (4 km), es ließ sich herrlich baden, und abends konnte man ohne Angst ins Bett gehen und die ganze Nacht ruhig schlafen. Erst als ich umgeschult werden sollte, holte mich meine Mutter wieder zu sich. Sie war mit meinen Geschwistern bei den anderen Großeltern in der Nahe von Itzehoe untergekommen.
erstellt am 19.04.2004
Schule im Krieg
von Ellen Probst
Für die auf dem Lande lebenden Kinder war es immer schon schwierig, eine weiterführende Schule zu besuchen. 1943 wurde ich auf die Auguste-Viktoria-Schule, einem Mädchengymnasium in Itzehoe, umgeschult. Um von unserem Dorf dort hinzukommen, musste ich die Eisenbahn benutzen. Das hört sich einfach an, war es damals aber nicht. Es handelte sich um die Strecke Hamburg - Westerland, und die Züge waren immer brechend voll. Ohne die Hilfe der Schaffner wären wir jungen Schüler häufig nicht mitgekommen. Ich bin sogar einmal ins Klofenster gehoben worden und musste alles dransetzen, an meinem Zielbahnhof wieder aussteigen zu können.
Die Personenzüge fuhren nur morgens und abends. Mein Großvater holte mich dann ab, es war immerhin dann schon nach 20 Uhr.
Vaale ist die letzte Station südlich des Nord-Ostsee-Kanals und damit vor der Hochbrücke, woher der Zug gut sichtbar herunterkam bzw. dort hochfuhr. Er wurde des öfteren von Tieffliegern beschossen. Hinter der Lok und auch am Ende des Zuges befand sich eine Flak. Sie konnte zwar wenig ausrichten, aber es beruhigte etwas.
Bei Luftgefahr durften wir Schüler nicht einsteigen. Es kam manchmal vor, dass das Gefahrenschild erst während der Abfahrt aus dem Bahnhof herausgestellt wurde. Wir bildeten uns ein, es sei unseretwegen. Man wollte uns ärgern, wir sollten in die Schule fahren. An der nächsten Station mussten wir in solchen Fällen wieder aussteigen. (Es war verboten, im Zug zu bleiben.) Wir liefen dann durch die Wilstermarsch zurück nach Hause. Vor den Tieffliegern versteckten wir uns in den Entwässerungsrohren, die in den Überwegen zu den Wiesen waren, um nicht von den Geschossen getroffen zu werden. Wir hatten große Angst.
Zunächst war das Gymnasium noch eine funktionierende Schule, wenngleich auch die wehrtüchtigen Lehrer alle eingezogen waren, und das Lehrpersonal überwiegend bereits das Pensionsalter erreicht hatte. Unsere Klassenlehrerin wurde liebevoll "Omi Frahm" genannt.
Die auswärtigen Schüler konnten, wie bereits erwähnt, erst abends nach Hause fahren. Für mich war es anfangs ein Problem, die Wartezeit zu überbrücken. Zwar gab es so genannte Wärmestuben für Leute, die ihre Wohnung nicht ausreichend beheizen konnten, dort wurde auch eine Suppe ausgegeben, nur Schulaufgaben machen, das durften wir dort nicht. Es könnte ja Tintenflecken auf den Möbeln geben.
Nun war guter Rat teuer. Wo bleibt ein zehnjähriges Mädchen, wenn der Zug erst um 19.30 Uhr fährt? Zum Glück half uns eine ehemalige Schulfreundin meiner Mutter. Ich konnte zu ihr kommen, wurde versorgt und hatte auch die Möglichkeit, meine Hausaufgaben zu erledigen. Trotzdem war es für mich eine anstrengende Zeit. Ich wurde immer nervöser und konnte schlecht einschlafen. Flugzeugmotoren versetzten mich in Panik, denn was die Bomberpulks anrichten konnten, kannte ich von Kiel. Meine Leistungen waren nicht mehr die besten.
Für die Schulleitung wurde es zunehmend schwerer, den Unterricht aufrecht zu erhalten. Eines Tages hieß es: "Unsere Schule wird Lazarett'. Das war im Winter 1944/45. Für eine kurze Zeit wurde unsere Klasse in die Räume des Finanzamtes verlegt - bis dann nichts mehr ging.
Mein letztes Zeugnis datiert vom 27. März 1945.
erstellt am 19.04.2004
Abiturientenprüfung 1939
von Ingeborg Nygaard
Wir schreiben das Jahr 1939.
Ich bin zum Zeitpunkt der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen 17 Jahre „jung“ und das Leben liegt wie ein aufgeschlagenes Buch vor mir. Am 15. März 1939 endete meine Schulzeit mit der mündlichen Prüfung und einer Abschlussfeier nach 12 Jahren.
Aber so einfach anfangen, was man wollte, konnte man damals nicht. Denn seit der Einführung der verkürzten Schulzeit, ca. 1936/37, wurde für uns Mädchen eine Art praktisches Jahr im unmittelbaren Anschluss an die Schule eingeführt. Das war obligatorisch, denn das Reifezeugnis wurde uns erst ein Jahr später ausgehändigt, natürlich unter Vorlage der entsprechenden Belege. Dieses praktische Jahr unterschied sich von dem Pflichtjahr, das alle Schulabgängerinnen in Haus- oder Landwirtschaft leisten mussten.
Wir hatten diverse Wahlmöglichkeiten. Ich entschied mich für einen Halbjahreskurs an einer staatlichen Frauenschule und für ein halbes Jahr Reichsarbeitsdienst (RAD). Letzteres war besonders wichtig für mich, weil ich studieren wollte, denn außer dem Abi-Zeugnis musste man bei der Immatrikulation den Nachweis des geleisteten Dienstes im RAD vorlegen können.
Wir Abiturientinnen des Jahrgangs 1939 bekamen durch den Ausbruch des Krieges am 01.09.1939 einige Schwierigkeiten, unser Programm planmäßig zu absolvieren. Die Frauenschule stellte bereits im August den ganzen Unterricht um, und ich bekam meine Einberufung zum RAD bereits für Mitte September. Anfang Oktober wäre normal gewesen.
Die Abiturientinnen, die zuerst zum RAD gegangen waren, also im April 1939, bekamen die Möglichkeit, bereits im Januar 1940 mit dem Studium zu beginnen. Sie hatten den erforderlichen Dienst bereits geleistet. Durch die Kriegsereignisse erhielten alle Abiturientinnen bereits Anfang Januar 1940 das Reifezeugnis ausgehändigt.
Mir nutzte das nichts. Ich bin erst am 29.03.1940 aus dem RAD entlassen worden.
An den Universitäten gab es schon seit einiger Zeit Trimester statt Semester, so dass man das Studium im Januar beginnen konnte.
Durch meine Beschäftigung mit dieser Zeit und ihren Ereignissen fällt mir ein, dass auch schon zur Mittleren Reife, heutiger Realschulabschluss, der Nachweis hauswirtschaftlicher Kenntnisse erforderlich war. Das waren einer Art nachmittäglicher Kurse. Man wollte uns Mädchen eben zu Frauen und Müttern erziehen und nicht zu „Blaustrümpfen“.
Erläuterungen
Blaustrumpf: Alter Spottname für intellektuelle, unpraktische, weltfremde Frauen und Mädchen. Der Name geht zurück auf einen literarischen Damen-Kreis in London um 1750. Angeblich war der englische Naturforscher und Literat Stillingfleet dort ein häufiger und gern gesehener Gast und er soll stets in blauen Kniestrümpfen erschienen sein, was nachgemacht wurde.
RAD=Reichsarbeitsdienst: Für Frauen betrug die Dienstzeit seit Kriegsbeginn 1939 sechs Monate, die jedoch häufig durch eine Notdienstverpflichtung verlängert wurden. Im Juli 1941 wurde die Dienstzeit durch den Kriegshilfsdienst um weitere sechs auf zwölf Monate ausgedehnt, im April 1944 auf 18 Monate verlängert und im November 1944 schließlich vollständig entfristet. Die durch die Dienstzeitverlängerungen des Jahres 1944 gewonnenen zusätzlichen Kräfte kamen überwiegend als Flakhelferinnen* zum Einsatz.
Vor September 1939 wurde bei dem von Frauen abzuleistenden Dienst vom so genannten FAD, also Freiwilligen Arbeitsdienst gesprochen.
*Flakhelferin. Die Abkürzung Flak = Flugabwehrkanone wurde in der Umgangssprache ein eigenständiges Wort.
Die Schultüte

Ingeborg Nygaard
von Ingeborg Nygaard
Am 20.04.1927 war der große Tag – Einschulung! Mein ganzer Stolz war eine Riesen-Schultüte, die mir meine Oma aus dem Voigtland liebevoll gefüllt und mir mit der Post zugeschickt hatte.
Zehn Jahre später holte meine Mutter das sorgsam aufbewahrte Stück vom Boden, um es mir beim Schulwechsel, Übergang vom Paulsenstift zum Lerchenfeld, neu zu füllen. Unten in der Spitze steckte noch das alte Papier zum Ausfüllen des Hohlraumes - dachten wir! Wer beschreibt unser Staunen, als wir in dem Knüllpapier etwas Hartes entdeckten! Eine schöne Schachtel kam ans Licht, gefüllt mit einer vertrockneten Masse, alles weiß beschlagen und verschimmelt! Pralinen!
Jetzt wussten wir endlich, warum die Oma ein paar Mal so von hinten herum gefragt hatte, was wir von Trömel`s Köstlichkeiten halten, dem 1. Kaffeehaus am Platze.
aufgeschrieben 19.08.2003
Internet-Recherche
Kaffeehaus Trömel in Plauen/Voigtl.
Im Jahre 1880 eröffnete Emil Trömel in Plauen eine kleine Konditorei mit Kaffeeausschank. Der Kundenkreis vergrößerte sich enorm schnell. So wurde eine Vergrößerung des Geschäfts geplant und im Jahre 1883 verwirklicht. Es entstand das berühmte Café Trömel am Postplatz. Ständig wurde erweitert und ausgebaut, da der Kaffeehausverkehr eine ungeahnte Ausdehnung gewonnen hatte. Die Einwohnerzahl Plauens stieg von Jahr zu Jahr und der Gästeansturm nahm erheblich zu. 100 Personen fanden im Café Trömel, dem beliebtesten Treffpunkts Plauens, eine Beschäftigung. Emil Trömel starb 1930 im Alter von 76 Jahren. Seine Söhne führten das Geschäft weiter. 7000 Gäste wurden an einem Tag gezählt. Allein der Garten hatte 2000, der Billardsaal 650 u. das Lokal 450 Plätze. Im Jahre 1950 wurde das Café an die HO verkauft, also enteignet.
Zur Erinnerung an das Kaffeehaus Trömel eröffnete der Konditor- und Bäckermeister Bernd Ebert das Nostalgiecafé Trömel 1990 im Klostermakttreff.
gefunden unter „cafetroemel.de“ 2011
Schulzucht vor fünfzig Jahren
von Jürgen Hühnke
Das "Staatliche Athenaeum - Gymnasium für Jungen" zu Stade, 1588 als Lateinschule aus dem dortigen Kloster St. Jürgen hervorgegangen, war eine .Bildungsanstalt, deren Ansprüche an Leistung und Disziplin mit ihrer ehrwürdigen Tradition einhergingen. Nur wenige Fehler in Orthographie, Interpunktion und Grammatik genügten zum Beispiel, um einen Deutschaufsatz gründlich zu verderben, In der Unterprima galt bei den Herren Doctores Osthus oder Olzscha die Regel, dass ein inhaltlich exzellenter Besinnungsaufsatz nur noch mit der Note »befriedigend" bewertet wurde, wenn in den fünf Stunden angestrengter Hirnarbeit im Text nur zwei Kommafehler entstanden waren.
Schulleiter war zu meiner Zeit Dr. Mohrhenn, den wir - freilich nur unter uns - respektlos Sumpfhuhn nannten. Hätte es heutige PC-Spiele schon damals gegeben, wären wir alle wohl Mohrhuhn-Freaks geworden.
Dr. Mohrhenn war ein äußerst korrekt gekleideter Herr, trug ein Korsett, ein Monokel und bis über die Schuhe weiße Gamaschen. Seine Bassstimme trug, selbst wo sie nicht kommandeurhaft ausgespielt wurde, weit über den Schulhof, furchtgebietend stärker als ein Donkosaken-Bass, so dass Schule und Pausenhof seine Anweisungen schlagartig wie die Kommandos eines Generals befolgten.
Einmal, so um 1952, hatten einige Pennäler etwas ausgefressen, wohl etwas relativ Harmloses wie die Anwendung einer Stinkbombe. Die Schüler mussten sich komplett in der Aula versammeln und etwa zwei Stunden ausharren, bis ihnen der eigentliche Grund dieser Plenarsitzung eröffnet wurde. Erst hielten unsere drei Studiendirektoren z. Wv. -Vertriebene, die noch nicht wieder ihrer alten Funktion entsprechend eingesetzt werden konnten - nacheinander je eine Rede über Schuldisziplin im allgemeinen und besonderen, dann mussten die drei Sünder vor dem Plenum aufstehen und kriegten die Haare gewaschen, indem ihnen eröffnet wurde, dass sie hiermit relegiert seien.
Weniger drakonisch fielen die reichlichen "kleinen" Bestrafungen aus, nämlich maßvolle körperliche Züchtigungen. Wer sich eine Ohrfeige eingehandelt hatte, musste alte Ordnungsrituale befolgen und zu diesem Behufe aufstehen. Das gestaltete sich beim kleinsten Pädagogen der Anstalt, dem Chemiker Dr. Steckhan - Spitzname Piccolo - zu einem Schauspiel, das fast ein homerisches Gelächter hervorrief. Piccolo war ein waldschratartiges Männchen, das wahrscheinlich fast noch die für Kinder an der Bustür angebrachte 1-Meter-20-Marke unterlaufen hätte, ein lieber Kerl, der die Klasse manchmal wegen des Direktors heftig einnebelte, wenn einige von uns im Chemieunterricht heimlich geraucht hatten, Als er aber dem „langen Anders", der mit seinen 1-Meter-90 zeremoniegemäß aufgestanden war, die Ohrfeige verabreichen wollte, kletterte Piccolo wie ein Gnom vor dem Übeltäter auf den Tisch.
Dem allen ist aber hinzuzufügen, dass unsere Lehrer allesamt prächtige Pädagogen waren, bei denen es wirklich etwas zu lernen gab. Viele von ihnen waren filmreife Originale, etwa Mathe-Lehrer Dr. Rau, Igel genannt, der es, wie wir auszählten, in einer einzigen Schulstunde auf 104-maliges "Nicht wahr" brachte.
Dr. Mohrhenn, den ich in der Prima als Geschichtslehrer genoss, war der bei weitem fähigste Vertreter seines Faches, ein Didaktiker ersten Ranges. Die erste von ihm gestellte Aufgabe allerdings bestand darin, binnen vierzehn Tagen mehrere hundert Geschichtszahlen auswendig zu lernen. Ihm und den Herren Dr. Osthus und Dr. Olzscha verdanke ich immerhin die Wahl meiner Studienfächer.
verfasst wahrscheinlich schon im Jahre 2003
Erläuterungen:
relegieren= zurück versetzen
z.Wv. = zur Wiederverwendung; Beamte, die am 08.05.1945 ihren Dienstherrn verloren hatten (in der Regel Vertriebene bzw. Flüchtlinge), wurden in den 1950er Jahren gem. Gesetz zu Art. 131 GG wieder in ihre früheren Rechte eingesetzt.
Didaktik ist im engeren Sinne die Wissenschaft vom Lehren (also die Lehrkunst).
(fsch)
Ein Fall von Schulversagen
von Jürgen Hühnke
Als die Pisa-Schockwelle durchs Land ging und der öffentliche Diskurs die sattsam debattierten Auffassungen der Erben von 1968 einerseits und der Traditionalisten andererseits wieder aufleben ließ - Fördern oder Fordern, Kuschelpädagogik oder Lerndisziplin -, kam es mir wieder in den Sinn, dass auch ich selbst einmal in der Schule kläglich versagt hatte.
Ort: Volksschule, Grundstufe, 4. Klasse. Zeit: Winter 1944/45 Anlass: Eine Lehrprobe oder -prüfung, vielleicht auch eine experimentelle Seminar-Vorführung im Fach Mathematik. Jedenfalls suchten uns viele hohe Herrschaften heim, der Schulrat mit einem Rattenschwanz von Junglehrern oder Seminaristen, in der Überzahl weiblichen Geschlechts, so ein Aufmarsch wie bei der Chefvisite im Krankenhaus.
Wir Schüler bekamen Stäbchen oder Klötzchen verschiedener Farbe, Größe und Form in die Hand und sollten sie, soweit ich mich noch erinnern kann, nach irgendeinem Konzept ordnen.
Abstraktes Rechnen oder seine konkrete Anwendung auf Waren oder Gegenstände aller Art mochte ich gern, wohl weil ich mütterlicherseits aus einer Kaufmannsfamilie stamme. Aber diese Art der Kindergartenpädagogik versetzte meine Motivation auf den Null- oder gar einen Minuspunkt. Was sollte das mit einem solchen Kinderkram bloß bedeuten? Ich wurde aber erlöst, indem eine neben mir sitzende Dame mittleren Alters vom Typ Seminarleiterin sich statt meiner mit den Klötzchen aufgabenlösend betätigte. Sie tat das mit einer angenehm mütterlich-warmen pädagogischen Zuwendung und duftete dabei so schön nach Lavendel.
Ich hatte zwar versagt, bin aber, soweit ich weiß, nicht rot geworden dabei. Diese Lehrprüfung war für die Katz, da sie mich nichts Brauchbares lehrte. Dergleichen Klötzchenrechnerei benötigte ich nicht, wenn ich die Salden in den Geschäftsbüchern meiner Mutter hinauf- und hinunterrechnete. Der Vollständigkeit halber (und ganz ohne mich sonderlich rühmen zu wollen) muss ich hinzufügen, dass ich in meinem Abitursjahrgang die einzige Eins in Mathe hingelegt habe, aber das war ja auch durch eine Leistungsanforderung motiviert.
erstellt am 04.01.2008
Lob der Volksschule
von Jürgen Hühnke
Für die elementare Bildung wurde durch die Reformatoren die Volksschule eingerichtet, die bedeutende Leistungen erbrachte. Wenn ich zum Beispiel an meine Volksschule zurückdenke, fällt mir ein, dass wir bereits im vierten Schuljahr in abstraktes Denken eingeführt wurden. Wir vermaßen das Gebäude und brachten den Grundriss maßstabsgerecht zu Papier, was angesichts der bei einem Bauwerk aus den 1880er Jahren typischen Auswulstungen in Form von Erkern und Lisenen trotzdem bewältigt wurde.
Dieses Beispiel scheint mir nicht herausgegriffen zu sein: Auf der deutschen Volksschule lernte man wirklich Etliches und Hervorragendes. Mein Vater etwa, Absolvent einer solchen Bildungsanstalt, erlernte nach dem Abschluss den Beruf eines Schriftsetzers und arbeitete sich in einem kleinen Zeitungsverlag zum Korrektor hinauf. Sein Tage- oder eher Nachtwerk in dieser Funktion bestand im ständigen Berichtigen sowohl der Manuskripte der Redaktionskollegen als auch der endgültigen Vorlage, bevor frühmorgens die Rotationsmaschinen anliefen. Er war in der Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung denkbar perfekt. Dieses Urteil meine ich abgeben zu dürfen, weil ich selbst auch über Deutsch-Leistungskurse viele Gymnasiasten ins Abitur gebracht habe, die mit dieser Perfektion nicht konkurrieren konnten.
erstellt am 19.04.2004
Macho-Probleme
Selbst geborene Pazifisten müssen keine Schwächlinge sein, wie in der folgenden Geschichte berichtet wird
von Jürgen Hühnke
"Dieser Junge ist doch kein Umgang für dich!" hätte jeder Erwachsene ausrufen können, der meinem Schulkameraden Wolfgang begegnet wäre. Wir besuchten dieselbe Klasse, wohnten nicht weit von einander entfernt, hatten denselben etwa drei Kilometer langen Schulweg - also war Wolfgang mein natürlicher Freund. Wir heckten miteinander Streiche aus, brannten hunderte Meter Bahndamm ab und rauchten gemeinsam die ersten Chesterfield und Lucky Strike aus den Rot-Kreuz Päckchen eines französischen Kriegsgefangenen. Aber wir hatten gänzlich unterschiedliche Anlagen. Während ich ein durch ein Pazifismus-Gen geprägtes Lämmchen war, hob er sich durch Kraftgehabe hervor und prügelte sich überall zum Boss hoch.
Als er sich auf diese Weise in der Schule eine unangefochtene Position erobert hatte, meinte er eines Tages, nun müsse er auch wissen, wer von uns beiden der Stärkere sei. Ob wir wohl einmal unsere Kräfte im Ringkampf messen könnten? Dagegen war nichts einzuwenden, ich hätte denn ein Feigling sein müssen. Es dauerte nicht lange, und schon lag er mit den Schultern am Boden und flüsterte fast flehentlich: "Sag aber bitte keinem etwas davon!" Na gut, ich wollte in der Schule nicht den großen Macker markieren und konnte auf irgendwelche Siegerlorbeeren verzichten und schwieg.
erstellt am 25.05.2009
Aufklärung
Sexualkundeunterricht gab es zu unserer Zeit noch nicht.
von Jürgen Hühnke
In meiner Jugend bekam man sexuelle Aufklärung zumeist von der Straße, dementsprechend vulgär gefärbt. Aus der Schulzeit entsinne ich mich der Trauben von Quartanern (Siebtklässlern), die sich auf dem Schulhof von einem Klassenkameraden informieren ließen. Als ich mich dazugesellte, erfuhr ich aber nichts Neues.
Als die Pubertät kurz darauf erste süße Wünsche hervorrief und ich zu Mädchen erste Kontakte hätte knüpfen können, pflegte meine Großmutter, wenn ich mich irgendwohin auf den Weg machte, zu sagen: „Mach´ mir aber keine Dummheiten!“ Daraufhin fragte ich gern provozierend: „Wie meinst Du denn das, Oma?“ Eine konkrete Antwort, wurde mir nicht zuteil.
Nun wusste ich, dass Oma durchaus eine jugendbewegte Zeit hinter sich haben musste. Ihre Generation war ja geprägt durch das Heraufkommen neuer Bewegungen, des Wandervogels und der bündischen Organisationen sowie auch der FKK-Gruppen. Als junge Leute hatten meine Großeltern, nackt draußen auf dem Lande zeltend, die unliebsame Bekanntschaft mit empörten Bauern gemacht, die den Nackedeis mit Heuforken und Mistgabeln nachjagten.
In ihren reiferen Jahren war Oma Sexualberaterin ihrer sozialdemokratischen Genossinnen gewesen, die von ihr in den Gebrauch von Pessaren eingewiesen wurden. Wenn ich also keine konkrete Antwort bekam, so lag das beileibe nicht daran, dass Oma etwa prüde gewesen wäre. Da ich als Leseratte ein Vielfraß war, wusste sie freilich - oder ging stillschweigend davon aus -, dass mir der gute Van de Velde in ihrem Bücherschrank längst in die Finger gefallen und ich also über den dritten möglichen Weg zu meiner Aufklärung gekommen war.
verfasst 2003, gespeichert am 23.04.2004
Schulspeisung
von Fritz Schukat erstellt 28.02.2008
Im Jahre 1946 wechselte ich in die Oberschule III für Jungen in Berlin-Neukölln. Von uns aus bis zur Zwillingestr., wo sich das Schulgebäude auch heute noch befindet, sind es nach meinem Routenplaner genau 3,5 km. Mit dem Auto könne man das angeblich in 6 Minuten schaffen, steht im Begleittext. Für mich als pubertierenden, unterernährten Schlaks war das damals jedoch „j-w-d, janz weit draußen". Deswegen fuhr ich mit der Straßenbahn Linie 95 dort hin, die schon seit Herbst 1945 wieder auf der Sonnenallee vom Hermannplatz bis zum Baumschulenweg fuhr. Mit ein paar Schulkameraden, die ebenfalls dort zur Schule gingen, stieg ich an der Haltestelle Pannierstraße zu. Die Fahrt dauerte ca. 15 Minuten.
Unsere Schule hatte damals noch keinen eigenen Namen, sie hieß Zwillingsschule, weil die kleine Straße, an der sie liegt, die Zwillingestraße ist. Diese ruhige Vorstadtgegend wurde in den 20er Jahren am Stück geplant und gebaut, weshalb sie immer noch einheitlich aussieht. Die Schüler kamen aus allen Himmelsrichtungen, ab 1949 sogar mit der S-Bahn aus Zeuthen, Schulzendorf, Eichwalde usw., also den bereits außerhalb Berlins in der "Ostzone" liegenden Vorstädten. Das hatte damals schon politische Gründe.
Ich nahm erstmals schon nach der Umschulung in die O-III an der Schulspeisung teil. Davor, in der Volksschule, gab es so etwas noch nicht. Ab wann die Schulspeisung allerdings erstmals ausgegeben wurde, weiß ich nicht genau, ich meine aber, es begann erst etliche Monate, nachdem die westlichen Alliierten die ihnen im Vier-Mächte-Abkommen zugestandenen Sektoren in Berlin besetzt hatten. Neukölln gehörte dann zum amerikanischen Sektor Berlins.
Essenausgabe war in der „Großen Pause“, die nach der zweiten Schulstunde um Halbzehn begann. Etwa eine halbe Stunde davor kam der Wagen mit den Essenbehältern. Fleißige Helfer brachten diese in die Eingangshalle, wo sie auf lange, aber niedrige Holzbänke gestellt wurden. Wir stürmten sofort nach dem Pausenklingeln mit unseren Essgeschirren - meist waren die aus alten Wehrmachtsbeständen - in die Vorhalle und standen geduldig und diszipliniert an. Für die Ausgabe hatten sich Frauen aus der Umgebung gemeldet, u.a. auch die Mutter eines Klassenkameraden, bei der wir uns gerne anstellten, weil sie uns immer einen reichlichen Schlag Suppe einschöpfte. Zum Essen durften wir nochmals kurzfristig in die Klassenräume, aber ältere Mitschüler, denen die Lehrerschaft vertraute, passten auf, dass man nach der Esseneinnahme nicht im Klassenzimmer blieb. Waren die Zimmer geräumt, standen die Aufpasser grundsätzlich an den Treppen und ließen niemanden passieren.
An der Schulspeisung, die kostenfrei war, nahmen fast alle Kinder teil. Ich kann mich noch deutlich an die Kekssuppe erinnern. Das war eine sämige Suppe aus eingeweichten Keksen, die später auch mit Rosinen und Schokostückchen angereichert wurde. Aber es gab auch Kohlsuppe und Griessuppe, alles mehr oder weniger flüssig.
Die zivilisierte Art, sein Essen einzunehmen, war auch in der Schule die mit einem Löffel. Den hatte wohl auch jedes Kind. Ich lernte jedoch damals einen Schüler kennen, der seine Portion ohne irgendwelche Hilfsmittel von dem schmaleren Geschirroberteil direkt in den Mund schütteln konnte! Er war etwa ein Jahr älter als ich und besuchte die Klasse über uns. Da er jahrelang als Aufpasser mit seinem Blechnapf oben an der Treppe stand, glaube ich nicht, dass er den Schulhof während der großen Pause jemals betreten hatte.
Meine Mutter verstarb 1947 an Tbc. Deshalb durfte ich während der 3. Unterrichtsstunde an der Milchausgabe teilnehmen. Das durften nur Kinder aus besonders gefährdeten Familien. Diese Milch wurde jedoch aus Milchpulver mit heißem Wasser angerichtet und hatte deshalb wahrscheinlich mehr symbolischen als gesundheitlichen Wert, aber ich genoss es, vom Unterricht befreit zu werden.
Übrigens, der Junge, den ich oben beschrieben habe, der seine Portion in sich hineinschütteln konnte, wechselte etwas später „umständehalber“ in unsere Klasse. Seitdem verbindet mich mit ihm eine sehr enge Freundschaft, die bis heute hält.
Im November 2010 ist mein Freund "plötzlich und unerwartet..." gestorben, hieß es.
Er war krank, hatte Bypässe, trug einen Schrittmacher und hatte kurz zuvor
einen Defibrilator eingepflanzt bekommen und dennoch...! Es war nicht
"plötzlich und nicht unerwartet", aber viel zu früh. Lesen Sie auch meinen Artikel
"...aber Du würst nächstet Jahr 76" unter der Rubrik "Abschied".
Fritz Schukat am 18.07.2011
Erinnerung an die Schulzeit
von Uwe Neveling
Ich bin gerne zur Schule gegangen. Eingeschult wurde ich in den Kriegsjahren im südlichen Schwarzwald. Nach den ersten heftigen Bombenangriffen hatten wir meine Heimatstadt verlassen und uns in den Schwarzwald zurückgezogen. Hier erlebten wir dann auch das Kriegsende. An mein erstes Schuljahr kann ich mich kaum erinnern. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Schultüte bekommen habe. Ich weiß nur, dass dem Erlernen des Alphabets Fingerübungen vorausgingen. Wir mussten Linien und Bögen auf unsere Schiefertafeln malen. Danach erlernten wir die lateinischen Buchstaben, die großen und die kleinen. Wir befassten uns nebenbei auch mit der Sütterlinschrift, die ich heute noch lesen, aber nicht schreiben kann. Neben Lesen und Schreiben mussten wir auch Singen. Das wurde sogar benotet. Ich sang das schöne Lied: Du hast Glück bei der Flak Erna Sack! Und erhielt dafür ein mir nicht verständliches Mangelhaft. Das Fach Musik war bei mir auch in den späteren Jahren nicht beliebt. Die Noten blieben im unteren Bereich.
Nach der Rückkehr in die Heimat wurde ich in die zweite Klasse eingeschult. Drei Jahre lang musste ich die Volksschule an der Wasserstraße besuchen. Die Aufnahme auf das Goethe-Gymnasium habe ich dann nicht geschafft. Das Diktat war völlig misslungen. Ich war zu aufgeregt. Ich hatte mich aber schon von meinen Klassenkameraden in der Volksschule verabschiedet. Auf die Frage, ob ich die Prüfung bestanden hätte, antwortete ich mit einem forschen JA. Zu meinem Glück gab es noch die Jacob-Mayer-Realschule. Die Aufnahmeprüfung bestand ich mit Ach und Krach. Von da an entwickelte ich mich zu einem Prüfungsprofi.
Die sechs Jahre Realschule bereiteten mir keine Schwierigkeiten. Ich interessierte mich für Sprachen und Mathematik. Unsere Mathematiklehrer waren Respektspersonen. Peter S. war von untersetzter Gestalt und hatte einen mächtigen Spitzbauch. Er war für Algebra und Geometrie zuständig und erschien immer mit einem großen hölzernen Winkel-Dreieck und einem großen Zirkel. Nach dem Unterricht nahm er diese Utensilien wieder mit. Er war ein herzensguter Mensch, der seine Güte unter einer rauen Schale verbarg. Ich hatte einen guten Kontakt zu ihm. Es schien so, als würden wir uns gegenseitig schätzen. Ich war ihm wohl aufgefallen, weil ich bei einer Klassenarbeit als Einziger alles richtig gemacht hatte. „Wir Mathematiker!“ wurde zum geflügelten Wort und er meinte sich und mich damit. Ich gebe es zu. Ich bin heute noch stolz darauf. Unser Mathematiklehrer zum Ende der Schulzeit war im Krieg U-Boot-Fahrer gewesen und schon allein aus diesem Grunde für uns interessant. R. war unser Klassenlehrer. Bei ihm hatten wir Französisch und Geografie. Anfänglich mochten wir uns überhaupt nicht. Er hatte mich mal fürchterlich verprügelt, weil ich die Schweizer Seen nicht kannte. Jedes Mal, wenn ich auf der Landkarte auf einen See zeigte und den falschen Namen dazu sagte, bekam ich eine Ohrfeige. Und die Schweiz hat viele Seen. Später haben wir uns dann vertragen.
In der Schule entwickeln sich Freundschaften. Einige sind sogar von Dauer. So auch die Freundschaft zwischen Ottokar und mir. Wir waren sechs lange Jahre Banknachbarn und haben alle Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt und ertragen. Wir haben voneinander abgeschrieben und uns gegenseitig geholfen. Wir waren immer füreinander da. Das ist auch heute noch so. Wir haben die Ferien gemeinsam verbracht und uns zu Geburtstagen und Familienfesten eingeladen. Wir haben auch Auslandsreisen unternommen und unsere Sprachkenntnisse vertieft. Ottokar ist sehr religiös. Er hat mir mal erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ich habe es verstanden und achte es. Er hat aber nie versucht, mich zu missionieren. Er nimmt mich so, wie ich bin. Das wird wohl auch der Grund sein, warum unsere Freundschaft hält.
Lehre, Studium und Beruf erweiterten mein Wissen. Ich habe immer versucht, das Wissen anzuwenden und an andere weiter zu geben. Ich war zeitweise in der Berufsausbildung tätig und habe dort gelernt, komplizierte Sachverhalte verständlich darzustellen. Das kann man aber nur, wenn man schwierige Vorgänge selbst auch verstanden hat. Und wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man das zugeben. Eine falsche Information ist schädlicher, als eine nicht gegebene. Dazu gehört Mut. Wer gibt schon gerne zu, dass er etwas nicht weiß. Der ehrliche Umgang miteinander schafft Vertrauen.
Das menschliche Miteinander fordert auch im Alter Hintergrundwissen. Auch hier muss man ständig dazulernen. Und ist es nicht ein schönes Gefühl, wenn die eigenen Kinder um Rat fragen? Man wird noch gebraucht. Das alles setzt geistige Präsens und Aufnahmebereitschaft voraus.
erstellt am 04.06.2010
Kopfrechnen
von Uwe Neveling
Peter S. hatte graue Haare und einen Igelhaarschnitt. Er hatte ein rundes, rot gefärbtes Gesicht, sein Kopf saß ansatzlos auf seinem Körper. Auffällig war ein mächtiger Spitzbauch. Er kam immer mit offener Jacke und zugeknöpfter Weste zur Unterrichtsstunde. Wenn er die Klasse betrat, trug er in der rechten Hand eine alte, abgewetzte Aktentasche, unter dem linken Arm hatte er ein großes, hölzernes, rechtwinkliges Dreieck und einen Holzzirkel geklemmt. Er ging schnurstracks zum Podium, knallte seine Aktentasche auf den Tisch und lehnte Dreieck und Zirkel vorsichtig an den Tafelständer. Er blickte uns Respekt fordernd an und begann dann mit der Unterrichtsstunde.
Ich habe bei ihm viel gelernt. Algebra, Geometrie, Trigonometrie mit Sinus, Kosinus, Tangens, Kotangens, Potenzrechnen mit Logarithmentafeln, Wurzelziehen machten mir viel Spaß. Er merkte sofort, wenn einer nicht aufpasste. „Der Biermann braucht nicht aufzupassen, der Biermann kann schon alles. Biermann an die Tafel!“ rief er ins Klassenzimmer, wenn Biermann mal wieder unaufmerksam war. Dann war es mucksmäuschen still. Der Tafelgang konnte uns alle einmal treffen. Peter S. war ein herzensguter Mensch. Wir nannten ihn liebevoll Pedder. Das war nicht respektlos. Im Gegenteil, weil wir ihn respektierten, nannten wir ihn so. Unter einer rauen Schale saß ein butterweicher Kern.
Bei Pedder lernten wir mit Logarithmentafeln und Rechenschieber umzugehen. Mit Logarithmentafeln kann man Multiplikations- und Divisionsaufgaben durch einfache Addition und Subtraktion lösen. Gerechnet wurde im Kopf. Später lehrte er uns den Umgang mit dem Rechenschieber. Dabei werden die Logarithmuswerte in Form von Strecken dargestellt. Das Ergebnis kann man dann auf den festen und den beweglichen Teilen des Rechners ablesen. Mit Hilfe der Trigonometrie errechneten wir die Breite eines Flusses aus den Seitenlängen und Winkelgrößen eines rechtwinkligen Dreiecks. Auch die Höhe eines Baumes oder eines Gebäudes ermittelten wir leicht aus Hypotenuse, Ankathete, Gegenkathete und Winkelgröße. Mindestens drei Größen mussten bekannt sein. Wir gingen nach draußen und übten unsere Rechenkünste an naturgegebenen Objekten. Im Vergleich zu heute bereitete uns die angewandte Mathematik viel Vergnügen.
Ich bin froh, dass ich dieses händische Verfahren noch kennen gelernt habe. Hinter den heutigen Taschenrechnern und Computern verbergen sich oftmals komplizierte Programme, die auf Knopfdruck Ergebnisse liefern. Die Benutzer wissen oftmals nicht, wie sie zustande kommen. Es ist doch immer gut, wenn man hinter komplexe Vorgänge blicken kann. Dieses Wissen ging bereits bei der Nutzung mechanischer Rechenmaschinen verloren. Man lernte lediglich, mit den Maschinen umzugehen, die dann laut rasselnd Ergebnisse lieferten. Der einzige Unterschied zu heute besteht darin, dass man bei modernen Geräten außer Tastaturgeklapper nichts hört. Es ist doch langweilig: Aufgabe eingeben, Freigabetaste drücken und das Resultat entgegen nehmen.
Da hatten wir uns doch früher über ein richtiges Resultat noch freuen können, und es erfüllte uns mit Stolz, wenn wir alles richtig gemacht hatten!
erstellt am 06.03.2010
Wie Steine in den Rucksack kamen
von Uwe Neveling
„Vulkane haben unsere Erde geformt und formen sie noch immer. Das feurig flüssige Magma aus dem Erdinneren erstarrt zu Granit, Basalt, Gneis und Schiefer. Natürlich nicht sofort. Dazu braucht es Jahrtausende. Mit ungeheurer Wucht werden bei einem Ausbruch Asche, Staub und Bims aus dem Schlot in die Atmosphäre geschleudert. Kommt das Magma mit dem Grundwasser in Berührung, werden heftige Dampfexplosionen ausgelöst. Es bilden sich dann Kraterlöcher. In diesen Kraterlöchern sammelt sich im Laufe der Zeit Wasser. Man nennt diese kreisrunden Seen Maare“.
Mit Kreide malte unser Klassenlehrer einen Vulkankegel an die Tafel. Mit der Kreidespitze deutete er oberhalb des von ihm gezeichneten Vulkans die Eruption mit gestrichelten Linien an. Und mit der Breitseite der Kreide ließ er einen mächtigen Lavastrom die Vulkanflanke herunterfließen. Wir blickten etwas ungläubig als er sagte, er würde uns in ein vulkanisches Gebiet führen. Es wäre gar nicht so weit weg.
„Unter der Erdkruste in fünfzig Kilometer Tiefe brodelt es. Das flüssige Gestein drückt gegen die Erdkruste und hebt den Boden jedes Jahr um einen Millimeter an. In den Maaren könnt ihr Gasbläschen aufsteigen sehen. Sie zeugen von vulkanischen Aktivitäten. Ein Ausbruch ist jederzeit möglich. Der Letzte war vor elftausend Jahren.“
Die Ansprache unseres Klassenlehrers sollte uns auf unsere Klassenfahrt vorbereiten. Es ging in die Eifel. Die Reise war als Wanderung von Jugendherberge zu Jugendherberge organisiert. Unsere Begeisterung hielt sich in Grenzen. Mussten wir doch den täglichen Bedarf an Wäsche und Verpflegung mit uns herumschleppen. Die Fahrt sollte zehn Tage dauern. Und so kamen leicht dreißig Pfund Tragegewicht zusammen. Das alles musste in Rucksäcken oder Tornistern verstaut werden. Außerdem wurden Trinkflaschen benötigt, die am Gürtel getragen werden konnten. Essgeschirr und Essbesteck gehörten ebenfalls zur Ausrüstung.
In den frühen fünfziger Jahren bediente man sich noch aus alten Wehrmachtsbeständen. Rucksäcke und Tornister wurden eng am Rücken getragen. Tragegestelle gab es damals nicht. Man kam sehr schnell ins Schwitzen, und die Gurte drückten mächtig auf die Schulterblätter. Wir sollten uns nicht so anstellen, meinte unser Klassenlehrer. Schließlich wären wir mit sechzehn Jahren fast erwachsen. In der Schule würden uns die Lehrer schon siezen. Wir dagegen meinten, dass das kein Grund sei, uns in die Wildnis zu schicken. Wir interessierten uns damals mehr für Fußball und Mädchen. Es half nichts. Wir trafen uns am Abreisetag vollzählig und pünktlich am neuen Hauptbahnhof. Unser Klassenlehrer sah in kurzen Hosen piekfein aus. Seine Ausrüstung war vom Feinsten. An einer Schlaufe des Rucksackes hing eine kleine Spitzhacke. Der Stiel endete in einer Miniaturschaufel. Das Kombigerät machte uns misstrauisch, zu Recht, wie sich später herausstellte.
So machten sich fünfzehn erwachsene Schüler und ein erwachsener Lehrer auf die Reise. Wir fuhren durch Städte, die noch immer ziemlich kaputt aussahen. Der Zug ruckelte und zuckelte über teilweise ausgefahrene Gleise. Nach gut fünf Stunden erreichten wir Andernach. In der Jugendherberge übernachteten wir und starteten am nächsten Tag die Rundwanderung.
Ich erinnere mich noch an den Besuch einer Wasserfabrik. Das Wasser hatte natürliche Kohlensäure und wurde dort in der modernsten Abfüllanlage Europas in Flaschen gefüllt. Es machte uns stolz, fortschrittlicher als andere zu sein. Etwas Ähnliches hatten wir bei einer Besichtigung des Westdeutschen Rundfunks in Köln auch schon gehört. Damals war es der große Hörsaal, der als Modernster in Europa gepriesen wurde. Es ging also wieder aufwärts. Unsere geistige und körperliche Überlegenheit wäre ins Unermessliche gestiegen, wenn wir damals gewusst hätten, dass wir im darauf folgenden Jahr Fußballweltmeister werden. Wir wussten es zum Glück nicht. Und so blieben wir bescheiden und pflegten unsere schmerzenden Füße.
Wir besuchten auch das Benediktinerkloster Maria Laach. Es begrüßte uns ein Mönch in brauner Kutte, die mit einer breiten Kordel zusammengehalten wurde. Seit 1093 wären sie schon hier. Sie lebten im Zölibat und hätten jetzt Nachwuchssorgen. Dabei sah er uns werbend an. Wir schüttelten den Kopf. Das war nichts für uns, keine Mädchen!
Wenn man die sanften grünen Hügel der Eifel sieht, vergisst man, dass das gesamte Gebiet vulkanisch aktiv ist. Sieht man allerdings in den Maaren die Bläschen hochsteigen, kann man erahnen, was sich tief im Inneren tut. Und irgendwann wird es die Oberfläche durchbrechen. Als wir damals in der Eifel waren, gab es weder ein Erdbeben noch einen Vulkanausbruch. Es waren aber sehr heiße Tage. Täglich liefen wir dreißig Kilometer. Und immer dann, wenn wir an Felsbrüchen vorbei kamen, wurde angehalten. Unsere geologisch orientierte Lehrkraft griff zu seiner Spitzhacke (mit Schaufel) und hackte wild auf das Gestein. Man konnte die unterschiedlichen Gesteinsschichten erkennen, die sich im Laufe der Jahrtausende gebildet hatten. Von jeder Schicht erhackte er sich eine Probe. Alles wurde ordentlich verpackt und beschriftet. Zusätzlich zu unserem Gepäck mussten wir nun auch noch die Gesteinsproben schleppen. Tuffstein ging ja noch; der war leicht und porös. Die anderen Gesteinssorten erhöhten dagegen das Schleppgewicht. Wir mussten uns was einfallen lassen.
Wir besuchten ein Zisterzienserkloster. Die Zisterzienser haben bekanntlich ein Schweigegelöbnis abgelegt. Von dem Gelöbnis ließen wir uns nicht beeindrucken. Wir beschlossen, Dubletten verschwinden zu lassen. Besonders schwere Exemplare wurden umgepackt und in einem günstigen Moment unserem Geologen in den Rucksack gesteckt. Wir mussten dabei geschickt vorgehen. Gerd Bischof war unser Klassenbester. Wir machten ihm keine Konkurrenz, sollte er doch der Erste sein und es auch bleiben. Er war unser Lockvogel. Er verwickelte unseren Klassenlehrer in ein hoch wissenschaftliches, erdgeschichtliches Gespräch. Franz Biermann, der Listenreiche, schob das Gesteinspaket dann ungesehen in eine Seitentasche des Lehrerrucksacks.
Unsere Wanderung endete in Koblenz. Eine Jugendherberge gab es auf der Feste Ehrenbreitstein. Hier übernachteten wir noch einmal und fuhren am nächsten Tag nach Hause. Die Bundesbahn hatte sogar einen ganzen Waggon für uns reserviert. Wir genossen es, unsere müden Glieder auszustrecken. Unser Lehrer hatte offenbar nichts von der neuen Gewichtsumverteilung gemerkt, oder vielleicht doch? Er ging durch den Wagen und gab jedem eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Ich sollte einen Vortrag über Zisterzienser und ihre Klöster halten. Dabei grinste er hintergründig und schadenfroh.
erstellt am 18.05.2010
Warum waren sie anders ?
von Annemarie Lemster
Es war 1948. Ich ging in Sarstedt, einer kleinen Stadt zwischen Hannover und Hildesheim, in die Schule. Es war eine reine Mädchenschule. Da meine Großeltern schon immer hier gewohnt hatten, galten auch wir, trotz Ausbombung in Hannover, als Einheimische. In meiner Klasse waren wir 35-40 Mädchen.
Eines Tages stellte uns unsere Lehrerin zwei neue Mitschülerinnen vor: Waltraud und Christa, es waren Schwestern. Sie wirkten etwas schüchtern und waren am Anfang sehr still. Unsere Lehrerin erzählte, dass beide Mädchen aus dem Osten kamen und sehr viel Schlimmes erlebt hatten. Es waren Flüchtlinge. Zu Haus erzählte ich von meinen neuen Mitschülerinnen und merkte, meine Eltern und Großeltern reagierten etwas merkwürdig. Ich hörte Sätze wie: „Da auch schon?“ „Die nisten sich überall ein.“ „Hast du schon gemerkt, wie die riechen?“ Ich war damals 10 Jahre alt und konnte mit diesen Sätzen nicht viel anfangen. Erstaunt war ich nur über das Verhalten der Erwachsenen.
In den folgenden Tagen drehte sich in meiner Klasse alles um Waltraud und Christa. Sie wurden auf dem Schulhof an den Rand gedrängt. Auch da wieder Sätze wie: „Mein Vater hat gesagt, ich darf nicht mit euch spielen,“ oder „...ich darf nicht in der Bank neben euch sitzen.“ Dann wurde getuschelt: „Habt ihr gesehen, was die anhaben?“
So ging es eine ganze Zeit, und beide waren wie ein Fremdkörper in der Klassengemeinschaft. Obwohl ich von allem nichts begriff, ich machte auch mit. Immer auf der Suche, was war so schlimm an den beiden, bemerkte ich bei Christa immer sehr viel Speichel in ihren Mundwinkeln. Dadurch spuckte sie sehr oft beim Sprechen. Ich glaubte damals, die Lösung für das mir merkwürdig erscheinende Verhalten der Erwachsenen gefunden zu haben, denn spucken durfte man nicht, das war „ungezogen“.
Es hat lange gedauert, bis wir beide Mädchen als Klassenkameradinnen akzeptiert hatten. Nicht zuletzt, weil man von Christa, der klügeren, immer abschreiben durfte. Sehr viel später wurde mir bewusst, warum wir uns alle so verhalten haben, nur verstanden habe ich es bis heute nicht so recht.
erstellt am 21.04.2001
Konkav und nicht konvex
Wenn sich pensionierte Lehrer treffen und einer dem anderen erklären soll, was er vom Bauchnabelpiercing halte, dann kann das zu einer vergnüglichen Expertenanalyse führen!
von Jürgen Hühnke
In unserer aktiven Zeit war er gern in mein Dienstzimmer, den Stundenplanraum, zu einem Schwätzchen gekommen. Jetzt traf ich ihn um 2002 einmal beim Supermarkt wieder. Er hatte seine Enkelin im Schlepptau, deren Anblick bei mir Assoziationen aufkommen ließ an die vor vielen Jahren, nicht selten zu Blasenentzündungen Anlass gebenden Miniröcke. Hier stand Hexenschuss zu befürchten. Auch dachte ich an die Rede von männlichen Waschbrettbäuchen, bei denen ich immer die Vorstellung von etwas Welligem oder Delligem hatte, in Erinnerung an Großmutters Waschbrett, jene im Holzrahmen befindliche Wellblech- Rubbelfläche. Aber hier setzte eine ansehnliche junge Dame die freie Taille den Winden aus und ließ eine gepiercte Perle im flachen Bäuchlein erglänzen. Drittens kam mir unwillkürlich das Wort „Domina“ in den Sinn, weil der kleine Schmuck durch Masochismus motiviert sein musste.
Der frühere Kollege schickte das Mädchen zum Shoppen und setzte sich mit mir in ein kleines Café. In einer Grenzsituation zwischen Magengeschwür und Herzkollaps ließ er seinen Unmut über den Teenie aus.
Das Mädchen habe von ihm zum sechzehnten Geburtstag eine ansehnliche Summe erhalten und einen Teil davon, wie zu sehen sei, investiert. Ich frotzelte, dass er doch froh sein könne, wenn die Enkelin, wie viele andere auch ihres Alters, den Betrag nicht zwecks Ausgleichs an einem vermeintlich etwas knapp ausgebildeten Bindegewebe verwendet habe und sich nicht mit Silikon- oder Salzwasserbeutelchen habe ausrüsten lassen.
Aber dem verärgerten Großvater war nicht nach Scherzen zumute. Was ich denn nun im Ernst davon hielte? Also entwickelte ich ihm eine scheinbare Expertenanalyse:
Gut fünfzig Jahre habe das Hollywood-Ideal der Maße 90-60-90 unangefochten die Szene beherrscht - mit der Folge, dass eine Krankheit namens Bulimie auf den Plan getreten sei. In anderen Fällen seien Wellness-Kuren oder Psychiaterbesuche das Ergebnis gewesen - oder eben die Konsultation eines Plastischen Chirurgen (Eigentlich ein dämlicher Begriff, so wie dreistöckiger Hausbesitzer oder gebrannter Mandelverkäufer). Da sei es geradezu wohltuend gewesen, dass in den 70er, 80er Jahren ein geschlechtsneutrales Outfit zum Trend geworden sei mit Mädchenjeans oder Lagerfeld-Zöpfen. Diese Erscheinungen hätten der Zwangsnormierung des weiblichen Körpers Einhalt bieten können.
Jetzt also wieder die Umkehr zur Körperbetonung, schon lange vorbereitet durch die knappen T-Shirts mit brustdimensionierendem Aufdruck, zum Beispiel IDEAL, was man wohl auch als „I deal“ habe interpretieren können, jedenfalls bei Haschlieferantinnen.
Die Sozio- und Sexologen, so der zweite Teil der Expertise, würden uns die weiblichen Formen als Signalgeber interpretieren. Da sei die Brust das laktierende Organ für die Brut oder die hoch gewölbte Hüfte der Hinweis auf die Gebärfähigkeit des Beckens. Der flache Bauch nun, zusätzlich mit edlem Schmuck verziert, signalisiere die Jungfrau und Bisher-nicht-Geschwängerte, die noch zu haben sei. Wenn man an Alice Schwarzers Schlachtruf „Mein Bauch gehört mir!“ denke, sei das Piercing sicher auch manchmal der Hinweis auf eine abgetriebene Leibesfrucht. Schließlich aber könne die Plombierung des Nabels die Einnahme der Pille symbolisieren, also eine Geburtensperre.
Man gerate damit ins Fahrwasser von Friedrich Engels, der die kapitalistische Erfindung des Privateigentums als Motivation für das Patriarchat sah, auch die Frau zum Eigentum zu erklären, das selbstverständlich intakt sein müsse, noch von niemandem beschädigt oder mit Beschlag belegt. Das zur Schau gestellte Bäuchlein lasse sich in Verbindung bringen mit dem als Eselsbrücke zur Erlernung von Fachwörtern der Optik altbekannten Verslein:
„Ist das Mädchen brav,
bleibt der Bauch konkav.
Hat es aber Sex,
wird er bald konvex.“
An diesem Punkt der Analyse setzte der Kollege geräuschvoll seinen Latte macchiato ab und grollte, auf diese Weise könne man auch die anliegenden Ohren einer Frau als eindeutiges Zeichen dafür sehen, dass an der so Beschaffenen alle Einflüsterungen anderer Männer vorbeirauschen müssten, oder Frauenfesseln als Indiz dafür nehmen, dass deren Besitzerinnen vortrefflich nach Pampers anstehen könnten.
Er hatte also wenigstens seinen Humor behalten. Freilich ereiferte er sich dabei, als hätte ich seiner Teenie-Enkelin das Piercing gemacht oder es ihr gar aufgeschwatzt, um selbst einen Hingucker zu haben.
erstellt am 22.10.2008
Kampagne im Desinteresse der Bevölkerung
von Jürgen Hühnke
Die 68er Studentenrevolte hat so manches angestoßen und bewirkt, was noch heute weiterlebt, zum Beispiel die GRÜNEN oder die Bürgerinitiativen, die sich anfangs um Ortsumgehungsstraßen kümmerten und inzwischen bis zur Aktion „Stuttgart 21" angeschwollen sind. Manches damals Umstrittene hat keinen Bestand gehabt, so die Forderung nach Sportmatten in den Schulturnhallen für einen praxisorientierten Sexualkundeunterricht.
Eine der Flutwellen von Radikalfundamentalismus brach im Herbst 1973 über die Kirchengemeinde des kleinen Dörfchens Ellerau herein. Dieser Sprengel war gerade erst 1967 vom Kirchspiel Quickborn abgespalten worden.
Pastor Eckard Gallmeier, seit 1971 in Amt und Würden - wobei man die Letztgenannten ironisch verstehen möge -, wurde alsbald zunehmend politisch, ohne dass man seinen ideologischen Standort so recht hätte verorten können, weil er bewusst aus dem Verborgenen operierte. Die Konservativen hatten ihn vom ersten Tag an für einen Revoluzzer gehalten. Er provozierte sie mit langen, fettigen Haaren und einer Lederjacke, wie Motorradfahrer sie trugen. Im Unterschied zu den „Hell`s Angles" spielte er „The Lord's Archangle" - vorerst, bis zum Tsunami.
Der Mann war überdies auch Sozialpädagoge und wurde von den Jugendlichen bewundert. Auf diese Klientel setzte er. Mitte September 1973 veranstaltete er ein Tanzvergnügen namens „Jugendtreff' im Gemeindehaus und überließ die Durchführung dem Jugendobmann des Sportvereins. Der aber überließ die Minderjährigen nicht nur dem Alkohol, sondern über eine Stunde lang ganz sich selbst, indem er erst einmal zum Abendessen nach Hause ging. Sogar der Dorfpolizist war eingeschritten. Der ungefragte Kirchenvorstand, Hausherr und formal Verantwortliche für die Angelegenheit, stellte Gallmeier zur Rede und verlangte von ihm, bei „kirchlicher Jugendarbeit" auch anwesend zu sein. Das wurde rundheraus abgelehnt.
Daraufhin schaltete der Kirchenvorstand das Landeskirchenamt zur Bereinigung des Problems ein. Bischof D. Dr Friedrich Hübner kam nach Ellerau und erwies seiner Dorfgemeinde einen Bärendienst, sich leutselig lächelnd mit dem grinsenden Jugend-Idol „Galle" der Presse präsentierend.
In den nächsten Tagen sattelte Gallmeier kräftig drauf. Die Lokalreporter, die ihn als „fortschrittlichen" Kirchenmann ansahen, verbreiteten, was ihnen vorgefaselt wurde: dass der Kirchenvorstand seit Monaten einen „Kalten Krieg" gegen Galle führe und ihn „abschießen" wolle.
Das war teils richtig, teils falsch. Immerhin hatte ich ihm lange Hilfestellung gegeben, wenn er mit Outfit und Gebaren Anstoß erregt hatte. Noch ein Jahr zuvor hatte ich mich trotz heftiger Nierenkoliken vor der Presse für ihn eingesetzt. Der Zeitpunkt ist mir so gut erinnerlich, weil mein „Nephrolithikum", meine „Nierensteinzeit" (Paläo-, Meso- und Neolithikum sind die Alt-, Mittlere und Jungsteinzeit), mich tags darauf ins Hamburger Hafenkrankenhaus zur Entfernung eines Schrapnells von Ureterverschlussstein zwang, wo mir das Radio die Nachricht vom Mordanschlag der Palästinenser-Terroristen von der Gruppe „Schwarzer September" auf die israelische Olympiamannschaft zutrug.
Und jetzt dieses! Da wurde mir öffentlich das Image eines Karriereknickers und Pastorenkillers angeheftet! Hatte der junge Mann - 30 Jahre zählte er - jeden Bezug zur Realität verloren? Und die Journaille hob ihn allenthalben auf den Schild.
Dann jedoch überspannte der Egomane den Bogen vollends. Über eine Sitzung des Kirchenvorstandes ließ Gallmeier verbreiten, seine Absetzung solle betrieben werden, und rief seine Anhängerschaft zur Teilnahme an dieser von ihm als „öffentlich" deklarierten Veranstaltung auf. Dabei kannte das damalige Kirchenrecht keine öffentlichen KV-Sitzungen.
Die Gerüchte trieben Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen zu einer Großdemo auf die Straße und in den als Sitzungssaal vorgesehenen Raum des Gemeindehauses. Als das Tagungsgremium eintraf, sah es sich von einer vielzähligen, johlenden Menge teils umstellt, teils am Weg gehindert. Den Versuch, in den Keller auszuweichen, blockierten aufgebrachte Protestler durch gewaltsames Eindringen auch hier. Der Kirchenvorstand begab sich in den Gemeindesaal, wo bereits 250 bis 300 Krakeeler versammelt waren.
Unter einigermaßen normalen Umständen reagieren selbst hysterische Personen auf deeskalierende Maßnahmen besonnener. Hier freilich war jede Mühe umsonst, weil mit Bedacht über den ganzen Raum Gruppen verteilt waren, die jede missliebige Wortmeldung sofort mit Sprechchören abwürgten.
Als völlig neuer Gegner trat aus diesem Haufen Edda Groth, Jahrgang 1939, Pastorin der Simeon-Kirchengemeinde Hamburg-Bramfeld, auf den Plan, baute sich vor der Menge auf und erklärte die Leute zu einer „nach Kirchenrecht ordnungsgemäß zusammengetretenen Gemeindeversammlung". Das war zwar Kokolores hoch zwei, aber die Masse glaubte ihn, da immerhin eine Pastorin ihn verkündet hatte. Es gelang der Gallmeier-Groth-Gruppe, nicht nur die Sitzung endgültig zu spengen, sondern sie auch umzufunktionieren und einen Beschluss herbeizuführen, der KV solle gefälligst zurücktreten.
Mit diesem merk- und fragwürdigen Schachzug hatte „Galle" selbstverständlich so sehr überzogen, dass der Propsteivorstand ihn als Kirchenvorstandsvorsitzenden schasste und mir das Amt kommissarisch übertrug - mit der fatalen Folge, dass nunmehr vorzugsweise über mich Unschuldslamm die Hetz- und Schlammlawine hereinbrach. Die Agitation nahm zu und wurde ergänzt durch kommerziell gefertigte Aufkleber für Schulranzen. Damit gingen die Schüler auf die Straße und dito ins Gymnasium, womit sie mich treffen wollten. Selbst meine Kollegin Susi von den Jusos stand auf jener Seite der Barrikade als Mitglied einer „Volksbewegung"
Die so obskur wie perfide agierenden Sympathisanten firmierten in den vielen Flugblättern gegen KV und zunehmend gegen den „kapitalistischen" Textilfabrikanten als so genannte „Initiativgruppe für eine Gemeindearbeit im Interesse der Bevölkerung". Derartige Töne mussten bei jemandem wie mir, der in einem stalinistischen Elternhaus aufgewachsen war, mindestens ein „Aha!" auslösen. Denn was sollte das heißen: „...im Interesse der Bevölkerung"? Das war ein leninistischer Stil, lehrte doch der Histomat, der historische Materialismus Marxens, dass die Ausbeuterklasse das Volk mittels eines ideologischen Überbaus von Recht, Kunst, Tradition undsoweiter undsofort davon abhalte, das nötige „objektive" Klassenbewusstsein zu entwickeln - und Wladimir Iljitsch lehrte, dass die KPdSU-Bolschewiki als Vorkämpferin für die „wahren“ Interessen des Proletariats stehe.
Eine solche sozialistische Pionierfunktion dachten also Galle, Groth und Konsorten sich und ihren Fans zu. Oder waren es schon Hooligans?
Schon länger vermuteten Kirchenvorstandsmitglieder, der Pastor müsse in der kommunistischen Ecke lokalisiert werden. Dieser allerdings behauptete pressewirksam, er sei nicht Mitglied der DKP. Das war nicht einmal gelogen, doch ließ sich vorerst nicht ausmachen, welcher ideologische Standort seinen Kampagnen denn zugrunde lag.
Was er wirklich im Schilde führte, klärte sich erst nach und nach. Zunächst wurden die Lügen entlarvt, er solle versetzt werden. In Wirklichkeit nämlich hatte er selbst seine Versetzung nach Bramfeld beantragt. Offenbar also wollte er seiner Freundin Edda Groth näher kommen, mit ihr zusammenarbeiten.
Vom Versetzungsantrag erfuhr der Kirchenvorstand erst durch den Propsten, nicht durch Frau Groth und ihre „Krawallerie" im Gemeindesaal.
Die rebellischen Trends der Jahre 1971-72-73 waren zu verworren, als dass selbst ein politisch versierter Beobachter die weltanschaulichen Wirrnisse hätte entknoten können. Es war eine Zeit, in der einerseits die brav-bürgerlichen Bestrebungen der APO (Außerparlamentarischen Opposition) etwa gegen die Notstandsgesetze aufbegehrten, andererseits sich Dutzende kommmunistischer Splittergruppen oft feindselig divergierender Provenienz bildeten, hier marxistisch-leninistischer, dort maoistisch- antiimperialistischer Art. Ferner gab es noch den aufkeimenden Feminismus, der nicht weniger gespalten war, nämlich in matriarchalische Verklärinnen von Mutterschaft bzw. Menstrualzyklus und in Kombattantinnen der Alice Schwarzer im Kampf gegen den Schwangerschaftsparagrafen 218 und für die Aktion „Mein Bauch gehört mir!" Nicht zu vergessen die, je nach Gusto, Rote Armee Fraktion oder Baader-Meinhof-Bande. Es dauerte zwei Monate, bis ich durch eine Gewerkschafterin aus der Nachbarschaft erfuhr, dass in der ÖTV (Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, später = „verdi") ein Pastoren-Trio von sich reden mache, das für die kirchliche Jugendarbeit nicht die Bibel empfehle, sondern das „Rote Buch des großen Vorsitzenden Mao", die so genannte Mao-Bibel.
Ein gutes Stück lüftte sich der Schleier. Es wurde evident, dass „Galle" seine Anhänger in eine ähnliche „Kuturrevolution" führen wolle, wie Mao Zedong es in China vorexerziert hatte.
Bald auch fiel mir in Hamburg ein hektografierter Wisch in die Hände mit dem Titel „Rote Presse. Sozialistische Hamburger Studentenzeitung", herausgegeben von der „Sozialistischen Studentengruppe im KBW“. Also ließ ich mir von der im Juni 1973 gegründeten Dachorganisation die Statuten zusenden und staunte nicht schlecht, darin die Verpflichtung der Mitglieder auf die Devise „so offen wie möglich, so verdeckt wie nötig" zu finden. Das Motto der „Initiativgruppe" war damit decodiert.
Meine Neigungen zur Analyse ließen mich die „Rote Presse" mit den Galle-Flugblättern vergleichen. Diese simple investigative Bemühung zeigte auf, dass beide Erzeugnisse dasselbe eingeschwärzte, etwas unter der Zeile liegende kleine „a" aufwiesen, eine Macke der Schreibmaschine im Kirchenbüro. War das einmal erkannt, lag auch die Vermutung nicht fern, der Druck müsse auf der Rotationsmaschine der Kirche hergestellt worden sein.
Wie das gelaufen war, stellte sich auch schnell heraus. Gallmeiers geräumige Dienstwohnung nämlich beherbergte eine größere Anzahl Studenten, die dort wohl eine Parteizelle des KBW bildeten. Darunter befanden sich etliche Opfer des so genannten „Radikalenerlasses" zur Überprüfung der Beamten auf verfassungskonformes Verhalten. Es hatten sich nämlich besorgte Konfimandeneltern bei mir gemeldet, die berichteten, während einer Freizeit auf Fehmarn hätten die Jugendlichen mit entlassenen radikalen Lehrern „diskutieren" müssen - was konkret heißt, die Konfirmanden waren
massiv indoktriniert worden.
„Manipulation", neben „Repression" und „Autorität" einer der damaligen Kernbegriffe - hier fand sie in Reinkultur statt, auf eine, im doppelten Sinne, linke Tour eingesetzt. Und mit eben diesen Mao-Ultras bekam ich es zu tun, als ich eines Tages in „mein" Kirchenbüro spazierte, wo ich als KV-Vorsitzender schließlich Hausrecht genoss, um telefonisch mit dem Propsten einiges zu bereden. Erst nach mehreren Bemühungen bekam ich ein Freizeichen, und schon strömte ein zornschnaubender Haufe von Pastoratsbewohnern durch die Verbindungstür auf mich los und entriss mir den Hörer. Eine Weibsperson, in der ich die in der Presse abgelichtete Hamburger Verfassungsfeindin Marita Sowieso zu erkennen meinte, sprang als Furie wie ein Rumpelstilzchen mir in den Weg und fauchte: „Sie gehören am nächsten Baum aufgehängt!"
Wohlweislich kontert man solche barbarischen Vorkommnisse nicht, hält gezwungenermaßen still und geht heim.
Die übelnehmerische Reaktion meines Körpers auf alle Unbill dieser Wochen ließ gewissermaßen noch sechs Jahre auf sich warten und zwang mich erst dann zu einem ausgedehnten Aufenthalt in Genf, wo ich mich im „Hôpital de la Tour" mit einem Vierfach-Bypass versehen lassen musste.
Von all denen, die da so energisch wie verbohrt gegen mich gehetzt und demonstriert hatten, bekam ich nicht entfernt je eine Erklärung, geschweige denn eine Entschuldigung zu hören, nicht von Susi, der bei den Jusos organisierten Lehrerkollegin, nicht von „Galle"-Groupie Christel, nach ihrer Spätpubertät Lehrerkollegin meiner Frau. Aber nein, eine Entschuldigung gab es doch, sogar eine sehr ernst gemeinte, doch die kam aus der entferntesten Nachbarschaft, und zwar von einem Herrn, der bei der seinerzeitigen Kellerbesetzung weit voran gestanden hatte.
Bleibt zu fragen, was es mit Gallmeiers Anspruch auf sich hatte, politisch im Interesse der Bevölkerung zu handeln. Es hatte zwar ein Strohfeuer gegeben, ein nicht ungefährliches sogar, doch eigentlich hatte der KBW so wenig Resonanz, wie die SED wirklich Rückhalt gefunden hatte bei den „Massen" oder der „Arbeiterklasse" - was freilich erst durch eine echte Volksbewegung mit den Rufen „Wir sind das Volk!" bewiesen werden musste.
Das Verrückte war, dass die Groth-Gallmeier-Bande ausgerechnet in der Ellerauer Dorfbevölkerung einen maoistoiden Mainstream in Richtung Kulturrevolution hervorzurufen versuchte. Was der angebetete Mao Zedong so nannte, war eigentlich nichts als ein Aufguss des von Lew Trotzkij entwickelten Ideologems von der Permanenten Revolution. In der Theorie ging es vielen Linksgruppen darum, mit Parolen wie „Ho-Ho-Ho-Tschi-Minh!" so lange auf die Gehirne einzubrüllen, bis diese paralysiert den bourgeoiskulturellen Überbau der Gesellschaft verlassen würden, um die Dritte Welt den Klauen der United Fruit Company zu entreißen. Diese permanente Beeinflussung wurde „Kulturrevolution" auch deshalb genannt, weil Mao so hirnverbrannte Parolen ausgab wie „Beethoven kritisieren!"
Wie gesagt, Strohfeuer ja, Weltrevolution nein in Ellerau. „Galles" Wortführer in der „Initiativgruppe", ein Joachim Krüger, holte für seine Partei bei der Bundestagswahl 1976 im Wahlkreis 7 (Pinneberg) absolut magere 0,2 Prozent.
Was sagt man da noch? Juso-Susi, Studienrätin mit der Facultas Französisch, könnte zu einem Ausspruch raten, von dem kolportiert wird, er gehe auf den sonst unbekannten Literaten Desbarreaux zurück, der eines Freitags im Wirtshaus Eierpfannkuchen mit Speck orderte. Als guter Katholik hätte er auf letzteren verzichten sollen, denn durch das offene Fenster erschallte, als er sich über die Speise hermachen wollte, bei plötzlichem Platzregen, in gewaltiger Donnerschlag, so dass er ausrief „Tant de bruit pour une Omelette!" (Frei übersetzt: „Ach Gott..." , wahlweise: „Mein Gott, Petrus, was für ein Lärm um eine Portion Rührei mit Speck!")

